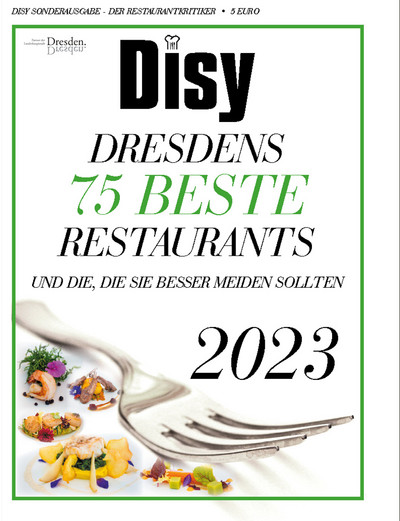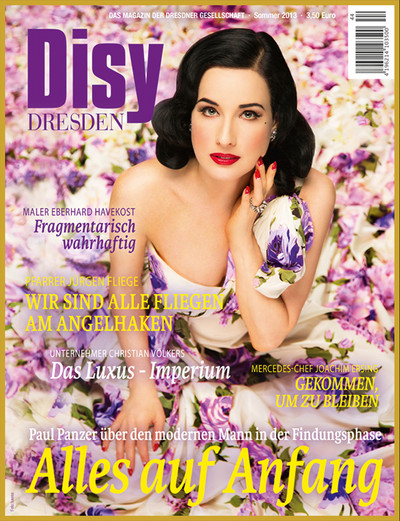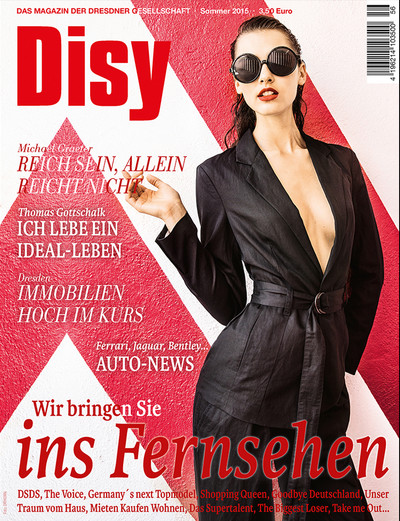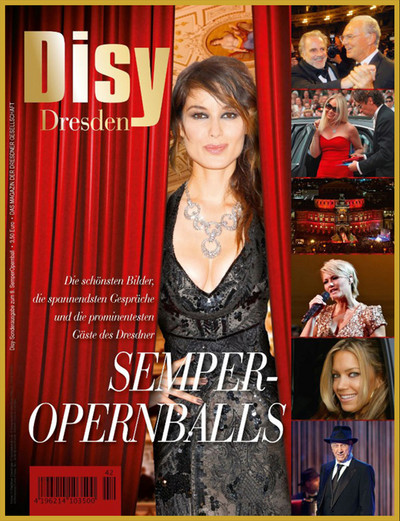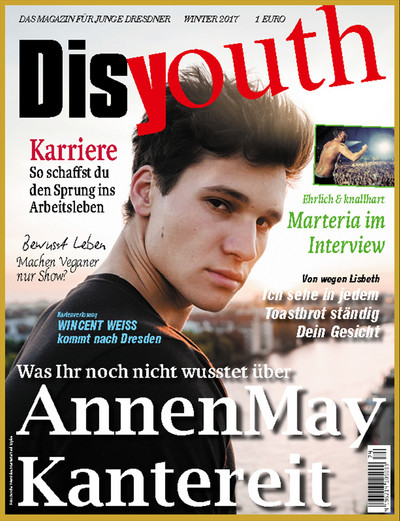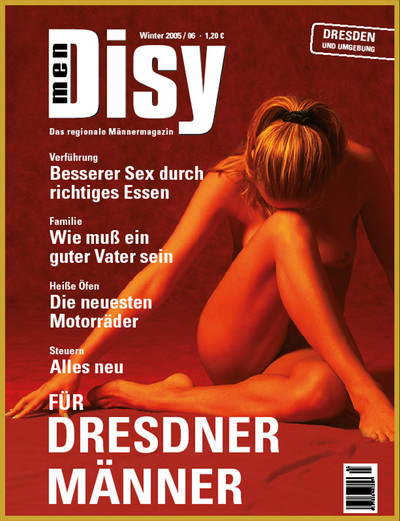- 3412 Aufrufe
Weniger Smartphone – mehr Spielplatz

Was raten Studien zur Minderung der Kurzsichtigkeit bei Kindern?
Professor Dr. med. Wolf Lagrèze, Leitender Arzt der Sektion Neuroophthalmologie, Kinderophthalmologie und Schielbehandlung, Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Freiburg
Aktuell ist weltweit eine drastische Zunahme der Kurzsichtigkeit (Myopie) zu beobachten. Bei den Betroffenen kommt es zu einer Zunahme der Länge des Augapfels, was nicht nur das Tragen einer Brille oder Kontaktlinse notwendig macht, sondern bei hoher Myopie auch einen beträchtlichen Risikofaktor für andere Augenerkrankungen wie Glaukom oder Makuladegeneration darstellt. Besonders die asiatischen Länder sind davon betroffen: In den städtischen Bereichen Chinas und Südkoreas liegt die Myopierate unter
Jugendlichen und jungen Erwachsenen inzwischen bei über 95 Prozent. Auch in Europa ist es in den letzten Jahrzehnten zu einer signifikanten Zunahme der Myopie gekommen. Aktuell liegt die Rate in Deutschland bei 35 Prozent. Nach jüngsten Schätzungen wird bis zum Jahr 2050 die Zahl kurzsichtiger Menschen weltweit auf 4,5 Milliarden zunehmen, 0,9 Milliarden werden hoch myop sein. Die Folgekosten sind immens. Myopie beginnt meist im Grundschulalter und erreicht einen stabilen Wert im Alter um circa 18 Jahre.
Durch genetische Faktoren sind solche Veränderungen nicht zu erklären, sondern nur durch Verhaltens- und Umweltveränderungen. Im Vergleich zu früher verbringen Kinder wesentlich mehr Zeit drinnen als draußen, was zum Teil an geänderten Spiel- und Freizeitaktivitäten liegt, zum anderen aber auch gerade in Asien in intensiviertem Lernverhalten, um den sozialen Anschluss im Bildungsbereich nicht zu verpassen. Neben der vermehrten Nahsicht ist vor allem die geringere Beleuchtungsstärke in Räumen dafür verantwortlich, welche zu einem relativen Dopaminmangel in der Netzhaut führt (300 bis 500 Lux drinnen gegenüber 20 000 bis 100 000 Lux draußen). Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass nach neusten Schätzungen zehn Prozent der Dreijährigen und 50 Prozent der Achtjährigen regelmäßig online sind, ist die Nutzung elektronischer Medien im Kleinkindesalter auch vor diesem Hintergrund kritisch zu sehen. In Taiwan beispielsweise wird eine Nutzung von Smartphones und iPads in gesundheitsschädigendem Ausmaß inzwischen unter Strafe gestellt. Aus diesem Land wurde auch eine zweiarmige prospektive Studie berichtet, in der gezeigt wurde, dass Schulkinder weniger oft myop werden beziehungsweise die Myopie weniger rasch fortschreitet, wenn sie die Schulpausen draußen anstatt drinnen verbringen. In Singapur werden derzeit taghelle Schulzimmer erprobt.
Welche Empfehlung kann man Eltern myoper Kinder geben?
Am sichersten durch eine Vielzahl von Untersuchungen etabliert ist der Effekt von Tageslicht. Hier sollte die Empfehlung lauten, dass Kinder zum Beispiel mehr als zwei Stunden am Tag draußen verbringen. Ab welchem Alter dies sinnvoll ist und ob es auch Myopie vor dem Auftreten vermeiden kann, ist noch unklar. Zu bedenken ist, dass eine solche Empfehlung in Konkurrenz zu den anderen Aufgaben der Kinder steht und eine sinnvolle Gesamtgestaltung der Schul-, Hausaufgabenzeit und Freizeit erreicht werden muss. So wird sich Naharbeit kaum vermeiden lassen. In Ergänzung kann dazu eine pharmakologische Maßnahme erwogen werden, nämlich die abendliche Gabe von je einem Tropfen Atropin 0,01 Prozent in beide Augen. In dieser Konzentration erweitert es nicht die Pupille und lähmt nicht die Akkommodation. In einer Studie aus Singapur hatte diese Therapie nach einer zweijährigen Gabe einen lang anhaltend positiven Effekt.
Als dritte Maßnahme kann als Alternative zur Brille eine multifokale Kontaktlinse empfohlen werden, welche der speziellen Form des myopen Auges angepasst ist und im Vergleich zur monofokalen Linse die Myopieprogression signifikant mindern kann.
OG, Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft
Professor Dr. med. Wolf A. Lagrèze
Leitender Arzt der Sektion Neuroophthalmologie, Kinderophthalmologie und Schielbehandlung,
Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Freiburg
Kurzvita
geboren 1965
1992–1994 Arzt im Praktikum (AiP)/Assistent Universitäts-Augenklinik Freiburg
1994–1995 Clinical fellow, Harvard Medical School, USA
1995–1996 Assistent Universitäts-Augenklinik Freiburg
1997–2000 Oberarzt Universitäts-Augenklinik Freiburg
2000–2003 Kommissarischer Leiter Abteilung Neuroophthalmologie/Schielbehandlung
seit 2003 Sektionsleiter an der Universitäts- Augenklinik Freiburg