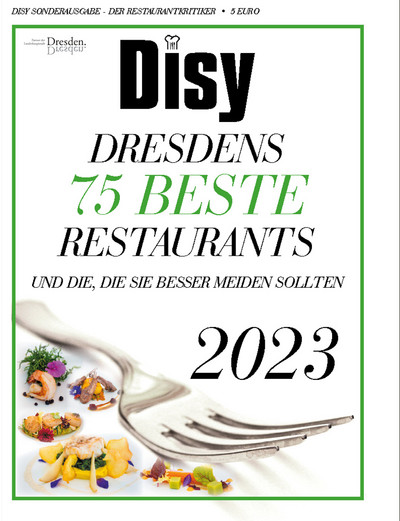- 3216 Aufrufe
106. Beitrag: "Mit Ali Baba durch Bombay" (27. April)
Meine Erfahrungen von einem Indienbesuch vor acht Jahren waren schrecklich. Indien war das einzige Land, das ich garantiert nie wieder betreten wollte. Aber es kommt immer anders...
Das Bild aus meiner Erinnerung: Waten durch zentimeterhohen Schlamm, der den Geruch einer Kläranlage hatte, eine Gruppe aus Menschen, die sich mit ihren schmutzigen Händen an meinen beiden Armen festkrallten, an meinen Haaren zogen. Krüppel, die wegen fehlender Beine auf dem Boden lang robbten und meine Füße festhielten und Männer in Röcken, die sich statt auf eine Toilette einfach auf den Fußweg hockten... Nie wieder Indien! Das stand für mich fest.
Als die "Amadea" dann in unserem ersten indischen Hafen, in Goa, festmachte, ging ich nicht von Bord. "Ihr werdet es verstehen, wenn ihr draußen seid", erklärte ich meinen Freunden. Als sie am Abend zurückkamen, schwärmten sie. Unglaublich, aber ihnen hatte die "Perle des Ostens", wie die Portugiesen ihre Kolonie nannten, die sie für 450 Jahre gehalten hatten, gefallen. Goa gehörte erst seit 1961 zu Indien und unsere Freunde erzählten von der kulturellen Mischung aus indischen und portugiesisch-mediterraner Kultur. Wenige Bettler hätte es gegeben, kaum Elendsquartiere - es war zwar schmutzig und arm, aber nicht so wie es in meiner Erinnerung war.
In unserem nächsten indischen Hafen - Mumbai oder Bombay, wie es früher genannt wurde, schwankte ich schon etwas. Ich buchte einen Ausflug über das Schiff und sagte am Morgen doch noch kurzfristig ab, als ich die dunklen, verfallenen und schmutzigen Hafenanlagen sah und die finster blickenden Männer vom Schiff aus beobachten konnte. Der Ausflug war weg und ich schlenderte mit Louisa unruhig auf dem Schiff herum. An der Rezeption trafen wir Christian Adlmayer. "Geht ihr nicht raus?" In dem Moment kam ich mir ziemlich dumm vor. In Indien sein und nicht aussteigen? "Ihr müsst raus. Nehmt euch ein Taxi, fahrt zum Taj Mahal Hotel, geht zum Gate of India." Immer noch skeptisch fragte ich: "Allein?" Und mit absolutem und wahrscheinlich berechtigtem Unverständnis über diese Frage kam ein autoritäres "Natürlich allein. Außerdem seid ihr zu zweit, du und Louisa."
Diesen kleinen Schupps hatte ich gebraucht. Ich traute mir so viel im Leben und dann hatte ich Angst vor den Indern? Blödsinn!
Und während ich ohne weiteres Zögern zuzulassen ein paar Dollar aus dem Safe holte, Pässe und Landgangskarten organisierte, entwickelte ich einen gewissen Trotz: "Okay. Der Kreuzfahrtdirektor hat die Verantwortung. Er hat uns raus geschickt, wenn uns jetzt etwas passiert, ist er dran Schuld." Natürlich würde uns nichts passieren. Aber das konnte man ja provozieren. Zm Beispiel indem man sich den am schrecklichsten aussehenden Taxifahrer aussuchte. Vielmehr kam er auf uns zu. Wir verhandelten hart, schließlich war ich wütend, dass ich hier rausgeschickt worden war. Das Taxi war ein wackeliges Gefährt mit zerfetzten Sitzen, ohne Gurte und heraus gebrochenen Fensterscheiben. Louisa presste sich auf der Rückbank an mich und sagte immer wieder: "Huh, ich kann den gar nicht ansehen." Und ein wenig später: "Mama, haben die hier keine Zahnbürsten?" Es war eine unwiederholbare Chance, Louisa die Wichtigkeit des Zähneputzens ans Herz zu legen und, ihr Lieben, sie wird ihr Leben lang so akribisch Zähneputzen wie kaum ein anderer Mensch.
Der Taxifahrer fuhr laut hupend und schimpfend durch die pulsierende, schrille Megastadt. Es war heiß, laut, bunt, stickig, voll, eng, quirlig, hektisch und hätte mich eventuell einschüchtern können, wäre ich nicht so wütend gewesen. Christian Adlmayer würde schon sehen, was er davon hatte. Mehr als zwölf Millionen Menschen lebten in Mumbai und laut Aussage eines Passagiers, der es wiederum von einem Reiseführer gehört hat, sollen 80 Prozent der Einwohner kein Zuhause haben. In meinem Marco Polo Reisführer hatte ich über die gescheiterten Versuche gelesen, Kriminalität, Prostitution und Massenarmut einzudämmen. Doch je länger wir uns durch die Stadt schoben und je mehr Zeit verstrich ohne dass unser Fahrer Anstalten machte, uns ums Leben zu bringen, desto mehr öffnete sich mein Blick, entspannten sich meine Muskeln, wich dem Ärger und der Furcht ein gewisses Erstaunen. He, das waren richtig schöne Häuser. Ganze Straßenzüge lang stand ein schöner Kolonialbau neben dem anderen. Imposante Bauten aus der viktorianischen Zeit gemischt mit indischen Elementen. Der Fahrer hielt an verschiedenen Gebäuden und erklärte uns mit englischen Brocken und vielen Gesten wo wir waren: Am High Court, an der Victoria Station, der Universität mit dem 78m hohen Rajabai - Turm und später am Flora - Brunnen an der Mahatma Gandhi Road. Das war toll. Am Price of Wales Museum wagten wir uns ein ganzes Stück vom Taxi weg und spazierten durch den Park des Museums, in dessem spätkolonialem Gebäude indische Kunst aus allen Epochen gezeigt wurde. Es war toll. Wir wurden zwar von Händlern angesprochen, von Müttern mit Babys angebettelt und mit düsteren Blicken verfolgt, aber sie fassten uns nicht an, gingen uns nach einer Weile aus dem Weg und ließen uns ohne Handgemenge wieder ins Taxi einsteigen. Das war nicht das Indien, das ich kannte. Unglaublich wie sich dieses Land in acht Jahren zu seinem Vorteil entwickelt hatte.
Einen kurzen Streit gab es dann doch noch mit unserem Taxifahrer, der uns unbedingt in ein Teppichgeschäft fahren wollte. Ich versuchte es nett. Ich versuchte es bestimmt. Ich versuchte es böse. Keine Chance! Als sich die Falten auf der Stirn des Taxifahrers vertieften und sein Blick sich verdunkelte, waren mir auch die lebenslangen Vorwürfe, die sich der Kreuzfahrtleiter wegen unseres Ablebens machen würde, kein Trost mehr. Ich gab auf. Wir wurden in diesen Laden geschoben und ich versuchte cool zu bleiben. Ich lobte die Waren, nickte höflich und erklärte dann dem Taxifahrer, der am Eingang gewartet hatte: "Ich habe genau 30 Dollar mit. Du bekommst genau 30 Dollar. Ich kann bei deinem Freund hier gern etwas kaufen, aber dann kann ich dir nur noch den Rest des Geldes geben." Er schaute mich abschätzend an. Ich setzte eine bemitleidenswerte Miene auf und hob bedauernd die Hände: "Wir sind nicht reich." Und als Louisa ihren wunderbaren Leitspruch dieser Weltreise aufsagte: "She has no money", wirkte der wie überall sonst auch auf der Welt. Schimpfend und schnaubend gab der Fahrer uns den Ausgang frei. Kurz überlegte ich, ob wir überhaupt wieder in sein autoähnliches Vehikel einsteigen sollten. Aber als ich mich nach den Alternativen umblickte, nahm ich lieber das wenigstens schon bekannte Übel.
Vor sich hin schimpfend fuhr uns der finstere Mann zum legendären Taj Mahal Hotel. Doch das wackelige Auto durfte nicht mal vorfahren. Die Sicherheitsleute des Hotels stoppten den Wagen vorher, ließen uns aber aussteigen und passieren. Im Hotel selbst bewegten wir uns so selbstbewusst wie Hotelgäste. Wie als wären wir bisher gegen hohe Wellen angeschwommen und würden nun mit gleicher Kraft in ruhigen Gewässern schwimmen. Wir kamen kraftvoll voran. Das Hotel hatte der Industrielle Jamsetji Tata 1903 eröffnet und gehört zur Weltspitze der Hotelerie. Die Legende sagt, der indische Eigentümer hätte im ersten halben Jahr das Haus für englische Gäste verboten gehabt. Dafür habe ich aber keine feste Quelle gefunden. Gegenüber vom Taj Mahal Hotel befindet sich das Gate of India, ein 24m hohes Tor, das 1926 erbaut wurde und an den Besuch des britischen Königs George V. erinnern soll. George hatte sich zum Kaiser von Indien krönen lassen. Wir liefen zum Tor hinüber und die Geschichte des Hotelinhabers wurde glaubhaft.
Zwei Bettler begleiteten unseren Weg zurück zum Taxi. Als sie unseren Fahrer sahen erschraken sie so, dass sie gleich von uns abließen. Diese Wirkung brachte mich auf eine Idee. Ich fragte ihn, ob er uns die Armenviertel der Stadt zeigen könnte. Erst traut sie sich gar nicht raus, dann will sie allein mit Kind in die Armenviertel - ich gebe zu, ein gewisser Widerspruch steckt da drin. Aber so war es eben. Unser Taxifahrer, der Schreckliche, fuhr mit uns vorbei an Gebieten, die aus Hütten, Zelten und öffentlichen Plätzen bestanden. Schmutz, Schlamm, offene Feuer mit kleinen Töpfen darüber. Hier waren sie, die Krüppel, kranken Menschen und die Armen der Armen, die ich von unserem ersten Besuch in Erinnerung hatte. Wir stiegen ein Stück weiter am Waschplatz aus und der Taxifahrer bewährte sich, wie ich erwartet hatte, als guter Beschützer. Keiner traute sich an uns ran. Er zeigte uns den Waschplatz, wo man seine Wäsche abgeben kann und die beim Waschen auf große Steine gehauen wird, geputzt, gewrungen und aufgehängt.
Die Rückfahrt verlief schweigend. Wenigstens brummte er nicht mehr vor sich hin. Louisa hatte die Umklammerung meiner Taille auch gelockert und relativ entspannt beobachteten wir das quirlige Leben.
Am Hafen angekommen, musste ich noch ein Foto von unserem Taxifahrer, dem Schrecklichen, machen. Die Fahrer der anderen Taxis kommen zu uns, halfen beim Fotografieren, lachten. "Na, seid ihr mit Ali Baba gefahren?", fragte einer und haute mir anerkennend auf den Rücken. Ein anderer sagte: "Smart woman." Der dritte hielt mir seine Hand zum Einschlagen hin. Also im Vergleich mit den anderen Fahrern, die alle zwar indisch aber sonst relativ normal aussahen, schnitt unser Taxifahrer wirklich nicht gut ab. Trotzdem, irgendwie hatte ich ihn fast ins Herz geschlossen. Doch seine Hand zum Abschied erwidere ich lieber mit einem freundlichen Winken. "Ciao, Ali Baba", rief Louisa von der Gangway aus und fragte, ob das der gefährliche Räuber aus dem Märchen sei. "Was denkst du?", fragte ich zurück. Und Louisa antwortete: "Ich glaube, das ist er."
Anja Fließbach: Freitag, 27 April 2007, 14:56 Uhr