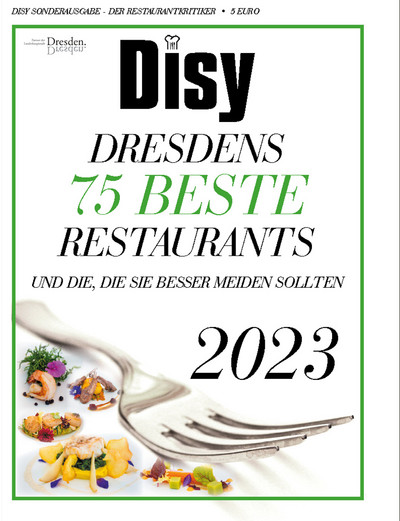- 4248 Aufrufe
Mein Recht als Arzt

Fachanwältin für Medizinrecht Anne Glaser gibt Auskunft
Auch Ärzte sind nicht vor Fehlern sicher. Vom kleinen Behandlungsfehler, über die falsche Medikation bis hin zu Unstimmigkeiten bei der Abrechnung. Wer haftet im Schadensfall und was sind generell Ihre Rechte als Arzt? Wir sprachen mit Fachanwältin Anne Glaser und geben Tipps zum Versicherungsschutz, worauf Ärzte beim Budget achten müssen und welche anderen strafrechtlichen Konsequenzen drohen könnten.
Habe ich als Arzt das Recht für oder gegen mich?
Glaser: Der überwiegende Anteil der Verfahren wegen behaupteten Behandlungsfehlern geht für die Ärzte gut aus. Häufig kann der Patient einen Fehler des Arztes einfach nicht beweisen. Und nicht jeder Schaden zieht gleich eine Haftung nach sich. Komplikationen und Folgeschäden können passieren, das kann man bei schweren und großen Operationen nicht verhindern. Die Frage ist meist eher, ob man dies hätte vermeiden können?
In welchen Verfahren vertreten Sie die Ärzte?
Glaser: Die Ärzte haben wir oft in Abrechnungsfragen vertreten. Wir haben aber auch Krankenhäuser als Dauermandanten. Wenn dort Verfahren wegen Behandlungsfehlern anhängig werden oder Fragen aus dem Vertrags- oder Arbeitsrecht auftreten, vertreten wir diese natürlich auch. Aber es ist einfach so, dass Behandlungsfehler meist von betroffenen Patienten oder deren Angehörigen aktiv verfolgt werden und Ärzte bzw. Einrichtung darauf reagieren müssen.
Was raten Sie den Ärzten, die sich mit einem Fehler auseinander setzen müssen?
Glaser: Wenn es sich um klare und beweisfähige Fehler handelt, dann sollten die Ärzte versuchen, sich unter Beteiligung ihrer Haftpflichtversicherung außergerichtlich mit dem Betroffenen zu einigen. An solchen Fällen hängen ja immer Schicksale von Menschen. Auch die Außenwirkung spielt dabei eine Rolle. Ärzte sind keine "Götter in weiß". Schäden können - insbesondere bei komplizierten Operationen oder in Notfallsituationen - eintreten, da Menschen keine Maschinen sind und jeder Mensch individuelle Besonderheiten hat. Die Ärzte sollten aber Schuldeingeständnisse immer nur nach vorheriger Rücksprache und im Einverständnis mit ihrer Haftpflichtversicherung abgeben, da ansonsten der Haftpflichtversicherungsschutz gefährdet wird. Zu berücksichtigen ist auch, dass die meisten Fehler in ihren Folgen nicht so gravierend sind, dass Dauerschäden zurückbleiben. Lässt sich der Fehler korrigieren und erfolgt dies in aktiver Zusammenarbeit mit dem Betroffenen, fühlt sich der Betroffene meist gut betreut und erhebt gar keine Ansprüche gegen den Arzt.
Was müssen Ärzte in Bezug auf den Versicherungsschutz wissen?
Glaser: Die Ärzte müssen grundsätzlich aufgrund ihrer Berufsordnung eine Haftpflichtversicherung haben. Ohne Nachweis der Haftpflichtversicherung erhalten sie keine Zulassung. Entfällt der Versicherungsschutz später, z.B. durch Nichtzahlung der Prämien oder Kündigung des Versicherungsvertrages, kann ein Zulassungsentzug drohen. Zudem haftet der Arzt dann persönlich, was ihn ruinieren kann. Die Mehrzahl der bestehenden Verträge ist mit Deckungssummen in Höhe von zwei Millionen Euro für Personen- und Sachschäden und 100 000 Euro für Vermögensschäden abgeschlossen. Für Personenschäden wäre aber eine höhere Deckungssumme, beispielsweise in Höhe von fünf Millionen Euro, ratsam. Auch deutsche Gerichte sprechen inzwischen bei schweren Dauerschäden hohe Schmerzensgelder und Schadensersatzzahlungen zu, auch wenn bei weitem noch keine amerikanischen Verhältnisse herrschen.
Man kann sich also vertrauensvoll nach den Empfehlungen der Ärztekammer richten?
Glaser: Auf jeden Fall. Dort werden die aktuellen Entwicklungen in der Rechtsprechung beachtet. Es kommt aber auch darauf an, ob man niedergelassener Arzt ist oder ob man als Arzt in einem Krankenhaus arbeitet. Krankenhäuser verfügen als Einrichtungen über eine eigene Haftpflichtversicherung und können - da die meisten stationären Behandlungsverträge mit dem Krankenhaus und nicht mit dem behandelnden Arzt direkt geschlossen werden - auch direkt in Anspruch genommen werden. Aber man muss immer daran denken, dass zwar das Krankenhaus als Einrichtung aus Vertrag haftet, der behandelnde bzw. verantwortliche Arzt aber auch aus Delikt persönlich haftet. Für Chefärzte gilt auch die Organhaftung.
Ein Arzt haftet also auch, wenn er angestellt ist?
Glaser: Ja, auch wenn er angestellt ist. Er hat dann unter Umständen im Innenverhältnis einen Ausgleichsanspruch gegenüber seinem Arbeitgeber. Nach außen haftet er aber sowohl zivil-, als auch strafrechtlich.
Laufen dann zwei Verfahren?
Glaser: Nein, soweit es um zivilrechtliche Ansprüche geht. Arzt und Krankenhaus bzw. Praxis werden zusammen als Gesamtschuldner in Anspruch genommen. Es liegt ein Lebenssachverhalt vor.

Müssen auch beide zahlen?
Glaser: Es handelt sich in diesen Fällen um eine gesamtschuldnerische Haftung. Der Geschädigte kann sich zwar aussuchen, bei welchem, möglichst solventen, Gegner er die anerkannten bzw. ausgeurteilten Ansprüche eintreibt. Mehr als die anerkannten bzw. ausgeurteilten Zahlungen erhält er aber nicht. Wie auf Behandlerseite der Ausgleich im Innenverhältnis erfolgt, ist deren Sache.
Wir alle wissen, dass weder persönliche noch finanzielle Abwägungen bei Behandlungen eine Rollen spielen dürfen. Doch in der Realität hat jeder Arzt auch mit der Wirtschaftlichkeit seiner Klinik oder seiner Praxis zu kämpfen. Worauf muss der Arzt hier achten?
Glaser: Zunächst ist zu beachten, dass für Behandlungen im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) nach dem SGB V und reinen Privatbehandlungen (mit und ohne private Krankenversicherung) erhebliche Unterschiede bestehen. In der GKV sind die zugelassenen Behandlungen und die Kosten stark reglementiert. Es bestehen Budgetregelungen und Strafregelungen bei Nichtbeachtung. Im Rahmen der privaten Krankenversicherung (PKV) sind ebenfalls die vertraglich vereinbarten Behandlungen und Kataloge zu Heil- und Hilfsmitteln zu beachten, da ansonsten der Patient erhebliche Eigenleistungen erbringen muss. Zunehmend wird auch bei der PKV sehr restriktiv geprüft und Rechnungskürzungen vorgenommen. Der Arzt ist dazu verpflichtet, seinen Patienten vor der Behandlung nicht nur über die Behandlung und deren Risiken sondern auch über Kosten aufzuklären, sofern eine Kostenübernahme durch die Krankenversicherung nicht sicher ist. Die gesetzlichen Krankenkassen zahlen auch nur die notwendigen, ärztlichen Versorgungen. Wenn es im Nachhinein Probleme mit der Bezahlung geben sollte, geht dies nicht zu Lasten des Patienten. Doch der Arzt hat dann ein Problem. Neben dem Ausfall der Vergütung und dem dadurch entstehenden wirtschaftlichen Schaden kann unter Umständen auch ein Abrechnungsbetrug im Raum stehen.
Wie kann das dem Arzt auf die Füße fallen? Wie kommt so etwas ans Tageslicht?
Glaser: Die Krankenkassen haben nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes das Prüfungsrecht, ob eine Behandlung notwendig war. Wenn dort die Meinung vertreten wird, dass die Behandlung nicht notwendig war, dann wird ein Prüfverfahren eingeleitet. Der Arzt kann dann die Notwendigkeit begründen, oft hat dies aber - gerade bei Grenzfällen - keinen Erfolg mit der Folge, dass der Arzt keine Vergütung für erbrachte Leistungen erhält.
Stimmt es, dass diese Prüfungen in Dresden, Sachsen und generell zunehmen?
Glaser: Ja, die Krankenkassen prüfen immer intensiver, gerade bei der Notwendigkeit von stationären Behandlungen und der Richtigkeit der Abrechnung. Es gilt der Grundsatz ambulant vor stationär. Der Arzt muss dann beweisen, dass alle ambulanten Behandlungsmethoden ausgeschöpft waren oder in der Person des Betroffenen Besonderheiten vorlagen, die eine stationäre Behandlung erforderlich machten. Diese Beweisführung bereitet oft Probleme.
Schwarze Schafe in der Ärzteschaft schieben sich gegenseitig lukrative Fälle zu. Das ist ja eigentlich verboten...
Glaser: Grundsätzlich gibt es ein Zuweisungsverbot gegen Entgelt. Die Musterberufsordnung für Ärzspricht Zuweisungsverbote in den Paragrafen 31 und 34 aus. Den dort allerdings noch bestehenden Interpretationsspielraum hat der BGH jetzt weiter verengt. Als unzulässige Einschränkung der Wahlfreiheit des Patienten gilt es bereits, wenn der Arzt dem Patienten von sich aus einen bestimmten Erbringer gesundheitlicher Leistungen nahelegt oder auch nur empfiehlt. Eine verbotene Zuweisung liege nur dann nicht vor, wenn der Patient den Arzt um eine Empfehlung gebeten hat. Der Patient hat das Recht der freien Arztwahl. Was der Arzt auf keinen Fall darf, ist, sich diese Zuweisung auf irgendeine Art und Weise vergüten zu lassen, sei es materiell oder in sonstiger Art und Weise.
In wie weit hat der Gesetzgeber den Interpretationsspielraum verengt?
Glaser: Mit dem Versorgungsstrukturgesetz 2012 wurde das bereits berufsrechtlich bestehende Verbot der Zuweisung gegen Entgelt auch in das SGB V aufgenommen. § 73 Abs. 7 SGB V sieht eine § 31 der ärztlichen Berufsordnung vergleichbare Regelung vor, wonach es Vertragsärzten nicht gestattet ist, für die Zuweisung von Versicherten ein Entgelt oder sonstige wirtschaftliche Vorteile sich versprechen oder sich gewähren zu lassen oder selbst zu versprechen oder zu gewähren. Damit hat der Gesetzgeber klargestellt, dass ein Verstoß gegen das Zuweisungsverbot gleichzeitig immer auch einen Verstoß gegen vertragsärztliche Pflichten darstellt. Durch die Regelung soll insbesondere ermöglicht werden, im Rahmen der Zulassung von (Teil-) Berufsausübungsgemeinschaften zu prüfen, ob diese nicht allein zu dem Zweck gegründet wurden, unzulässige Zuweisungen gegen Entgelt oder sonstige wirtschaftliche Vorteile zu verschleiern. Solche Verträge wären sittenwidrig und damit nichtig.
Was könnte im schlimmsten Fall passieren?
Glaser: Bei Verstößen gegen das vom BGH spezifizierte Zuweisungsverbot drohen erhebliche Konsequenzen. Neben den zivilrechtlichen Folgen nichtiger Verträge ist das fehlerhafte Verhalten auch strafrechtlich relevant. Der Arzt hat in der Folge mit einer hohen Geldstrafe, wenn nicht mit Freiheitsentzug zu rechnen. Mit einem Strafverfahren einher geht dann der Entzug der Approbation und der Zulassung. Das kann also böse enden
Kommen Behandlungsfehler in Dresden und Umgebung oft vor?
Glaser: Auch Ärzte und nichtärztliches Personal machen Fehler. Die letzte, mir bekannte, Statistik weist aus, dass die meisten Behandlungsfehler in der Pflege festgestellt wurden. Ärzte in der Akutversorgung sind also weniger betroffen. Meist sind es Orthopäden und Chirurgen, denen Behandlungsfehler nachgewiesen werden können. Einiges passiert auch im Kinderbereich, sowohl durch Geburtsschäden als auch bei der späteren Behandlung von Kindern, bei denen die Besonderheiten der kleinen Patienten nicht ausreichend berücksichtigt werden. Bei z.B. 13-jährigen Mädchen sollte man bei unklaren Bauchschmerzen auch einen Gynäkologen hinzuziehen und nicht nur an den Blinddarm denken. Auch wenn ältere Menschen mit ohnehin angegriffenem Gesundheitszustand betroffen sind, treten durch zwar indizierte Operationen oft Komplikationen mit schweren Folgeschäden auf. Es stellt sich dann die Frage, ob diese Patienten überhaupt OPfähig waren und ob die Aufklärung zu möglichen Risiken und Folgen ausreichend und verständlich war.
Was müssen Ärzte beim Aufklären der Patienten beachten?
Glaser: Weitreichende Folgen können Fehler im Rahmen der Aufklärung haben. Der Arzt trägt grundsätzlich die Beweislast dafür, dass er dem Patienten die Art und Weise der Behandlung und der Risiken/Vorteile erläutert hat. Bestehen verschiedene Alternativen muss der Arzt nicht nur über die von ihm favorisierte Methode aufklären, sondern auch die Alternativen mitteilen, die Unterschiede erläutern und die verschiedenen Vorteile und Risiken. Wenn sich z.B. Möglichkeiten einer konservativen Bandscheibenbehandlung mit Physiotherapie und eine operative Behandlung gegenüberstehen, dann muss der Arzt über beides aufklären. Er muss dem Patienten genau sagen, wie sein Zustand ist, welchen Erfolg, welche Dauer und welche Risiken eine konservative oder eben eine operative Behandlung haben. Im schlimmsten Fall könnte eine Operation schließlich zur Querschnittslähmung führen. Dann ist es die Entscheidung des Patienten, welcher Behandlung er zustimmt. Die Aufklärung muss auch immer mündlich erfolgen. Belehrungsbögen zum Selbststudium reichen nicht aus, selbst wenn der Patient sie unterschreibt. Dem Patient muss die Möglichkeit gegeben werden, Fragen zu stellen. Die Aufklärung muss auch so erfolgen, dass der Patient es versteht. Bei Patienten mit Migrationshintergrund und dadurch eingeschränkten Kenntnissen der deutschen Sprache, sollte der Arzt im Zweifelsfall einen Dolmetscher hinzuzuziehen. Auch Beeinträchtigungen im "Verstehen" müssen - soweit erkennbar - berücksichtigt werden. Bei Patienten mit entsprechenden Defiziten muss es so einfach wie möglich erklärt werden.
Wie soll sich ein Arzt verhalten, wenn er feststellt, dass ein Patient Probleme machen könnte?
Glaser: Das ist schwierig. Er hat schließlich eine Behandlungspflicht. Unterlassene Hilfeleistung ist ein Straftatbestand. Auch eine Nichtbehandlung kann zu einer Haftung führen, wenn eine Behandlung notwendig war und die Nichtbehandlung zu einem Schaden geführt hat. Andererseits hat der Patient auch eine freie Arztwahl. Wenn der Arzt sich nicht in der Lage sieht, sei es fachlich oder menschlich, den Patienten zu behandeln, sollte er einen anderen Arzt empfehlen. Dies darf aber nicht dazu führen, dass der Patient keine Hilfe bekommt. Man muss auch abwägen, ob es ein Notfall ist (dann müssen die Ärzte behandeln) oder ob es eine Sache ist, wo kein Zeitdruck bezüglich der Behandlung besteht.
Welches Recht hat der Arzt, wenn die Krankenkasse Vergütungskürzungen vornimmt?
Glaser: Zuerst bekommt er eine Mitteilung über die Vergütungskürzung. Zur Begründung wird auf die MDKPrüfung verwiesen, z.B. dass die DRG (Fallpauschale) nicht richtig gewählt worden ist oder die stationäre Behandlung nicht notwendig war. Dann hat er die Möglichkeit, dazu Stellung zu nehmen. Dann erfolgt ein zweites MDK-Gutachten. Werden die Begründungen des Arztes anerkannt, wird das Verfahren eingestellt. Wenn nicht, bekommt er einen zweiten - denWiderspruch zurückweisenden - Bescheid. Danach muss er sich überlegen, ob er die Kürzung akzeptiert oder er muss die Leistung einklagen. Leistungen aus der GKV sind vor dem Sozialgericht, Leistungen der PKV bzw. reine Privatleistungen vor dem Zivilgericht einzuklagen.
Wie sehen Sie die Chancen, die Leistung einzuklagen?
Glaser: Hier kommt es auf den Einzelfall an. Entscheidend ist immer eine gute Dokumentation der erbrachten Leistungen. Im DRG-System (Fallpauschalen) müssen die Hauptdiagnose richtig bestimmt und Nebendiagnosen vollständig erfasst werden. Ob die jeweiligen Voraussetzungen erfüllt sind, kann nur über die Dokumentation geprüft werden.
Gibt es noch mehr Risiken strafrechtlicher Art für den Arzt?
Glaser: Jeder Eingriff in den Körper eines Menschen ist grundsätzlich eine Körperverletzung. Sie ist zulässig, wenn der Patient sein Einverständnis nach vorheriger Aufklärung erteilt. Für die ausreichende Aufklärung ist der Arzt beweisbelastet. Der Arzt muss im Streitfall beweisen, dass er über die Behandlungsmethode selbst und deren Risiken so rechtzeitig aufgeklärt hat, dass dem Patienten die Zeit zum Überdenken geblieben ist. Bleibt der Arzt hier beweisfällig, führt das dazu, dass keine ordnungsgemäße Aufklärung vorliegt. Dann ist der Eingriff ohne Einwilligung erfolgt und damit rechtswidrig. Dann ist es wieder eine Körperverletzung. Der Arzt haftet dann - selbst wenn der Eingriff an sich korrekt erfolgte - nur aufgrund des rechtswidrigen Eingriffs zivilrechtlich auf Schadensersatz und Schmerzensgeld. Strafrechtlich drohen ebenfalls Konsequenzen.
Wie hoch können die Ansprüche der Patienten in solchen Fällen ausfallen?
Glaser: Hier kommt es darauf an, ob der Eingriff indiziert war und von einer hypothetischen Einwilligung des Patienten ausgegangen werden kann. Es kann nur der Einzelfall betrachtet werden, so dass es hier keine allgemeinen Regelungen gibt. Zu prüfen ist in solchen Fällen, ob von einer mutmaßlichen Einwilligung ausgegangen werden kann. Dies wäre dann der Fall, wenn der Patient auch bei ordnungsgemäßer Aufklärung in den Engriff eingewilligt hätte. Bei notwendigen und alternativlosen Behandlungen ist dies oft der Fall, so dass dann die Rechtswidrigkeit der Behandlung wieder entfällt. Diese Rechtsfrage muss aber im Streitfall durch ein Gericht bewertet werden.
Gibt es noch etwas, wo Ärzte vielleicht denken, ihre Versicherung kommt dafür auf, wo sie aber schnell in eine Falle tappen können?
Glaser: Kommt ein Patient und behauptet, es sei etwas schief gelaufen, sollte das der Arzt zur Kenntnis nehmen und sofort seiner Haftpflichtversicherung melden. Eine Prüfung der Behauptungen des Patienten und gegebenenfalls eine Behandlung muss selbstverständlich erfolgen. Die Versicherung ist aber der "Herr des Haftpflichtverfahrens". Wenn der Arzt vorschnell einen Fehler eingesteht, dann wirkt sich das unter Umständen negativ auf das Verhältnis zur Versicherung aus. Im Außenverhältnis kann der Patient dann meist den Fehler beweisen und erhält eine Entschädigung. Im Innenverhältnis kann es aber zum Verlust des Versicherungsschutzes kommen und zu Regressansprüchen der Versicherung gegenüber dem Arzt.
Und der Arzt muss bei Beschwerden oder Angriffen von Patienten seine Emotionen im Zaum halten..
Glaser: Unbedingt, man darf dem Patienten auf gar keinen Fall drohen. So etwas wäre grob standeswidrig und könntestrafrechtlich relevant sein. Der Arzt kann aber von seinem Hausrecht Gebrauch machen und einen z.B. randalierenden oder beleidigenden Patienten aus der Praxis/dem Krankenhaus verweisen. Notfalls muss die Polizei gerufen werden.
Worauf müssen Ärzte noch achten, was kann strafrechtlich noch passieren?
Glaser: Problematisch ist auch immer die Thematik der Sterbehilfe. Ein Unterlassen medizinischer Eingriffe auf der Grundlage einer vom Betroffenen verfassten Patientenverfügung oder einer sonstigen beachtenswerten Willensäußerung ist nach allgemeiner juristischer Auffassung keine aktive, sondern passive Sterbehilfe. Eine Behandlung gegen den Willen des Patienten, also das Missachten einer Patientenverfügung, erfüllt in Deutschland den Straftatbestand der Körperverletzung. Das Sterbenlassen einer Person durch Unterlassen medizinischer Hilfeleistung entgegen Therapiewünschen des Betroffenen erfüllt den Straftatbestand der Tötung oder unterlassenen Hilfeleistung und kann daher nicht als passive Sterbehilfe gewertet werden.
Darf der Arzt entscheiden, wann er bildlich gesprochen das Morphium final "hochdreht"?
Glaser: Nein, niemals! Morphin dient zur Schmerztherapie, nicht zum Sterben. Wenn Morphin dagegen ohne Indikation in der Sterbephase eingesetzt wird, ist es keine Sterbebegleitung, sondern Tötung. Ein Gericht hat in einem Verfahren, in dem es nicht um Palliativmedizin ging, sondern um eine - sich über das Selbstbestimmungsrecht der Patienten hinwegsetzende - aktive Tötung durch die Gabe nichtindizierten Morphiums, festgestellt, dass eine nichtindizierte Behandlung vorgelegen hat. Keiner der Patienten befand sich in einem Sterbeprozess und klagte über starke oder stärkste Schmerzen. Kein Arzt braucht Angst vor juristischen Konsequenzen zu haben, wenn er Morphium bei Indikation einsetzt, titriert und den Patienten überwacht. Außerdem muss kein Patient fürchten, dass ein Arzt seine Schmerzen nicht mit Morphium behandeln darf. So heißt es auch in einer Presseerklärung des Landgerichts Hannover im Januar 2011.
Und wenn der Patient eine Überdosis verlangt?
Glaser: Es geht nicht um Hilfe zum Sterben, sondern um Therapien in der Sterbephase. Im Vordergrund stehen Schmerzbehandlung und Sedierung, bei denen das Risiko in Kauf genommen wird, dass als eine mögliche Nebenwirkung der Eintritt des Todes beschleunigt wird, etwa weil das verabreichte schmerzlindernde Medikament eine Atemdepression auslösen kann. Wird dagegen eine medizinisch nicht gerechtfertigte Überdosis der entsprechenden Medikamente gegeben, um den Tod des Patienten gezielt herbeizuführen, liegt der Fall anders, weil es sich um die Tötung des Patienten handelt.
Also ist eine sehr hohe Dosis Morphium, die möglicherweise zum Tod führt, legal?
Glaser: Es steht außer Zweifel, dass es zulässig ist, im Rahmen einer gezielten Schmerzbehandlung Morphium auch dann einzusetzen, wenn dieser Einsatz die Beschleunigung des Todeseintritts als Nebenfolge in sich trägt. Aber eben nur zur Behandlung von anders nicht beherrschbaren Schmerzen. Der Patientenwille ist entscheidend und muss ermittelt werden. Dies gilt auch bei bewusstlosen Patienten, z.B. über vorhandene Patientenverfügung oder die Befragung der Angehörigen. Für Ärzte gelten auch die Grundsätze der Bundesärztekammer (BÄK) zur ärztlichen Sterbebegleitung.
Stimmt es, dass in Konfessionskrankenhäusern die Patientenverfügungen manchmal nicht akzeptiert werden?
Glaser: Dies ist vorgekommen unter Verweis auf Glaubensgrundsätze. Grundsätzlich hat der Gesetzgeber die Pflicht zur Beachtung des Willens des Patienten durch Ärzte zwar gestärkt. Andererseits kann man ein Krankenhaus oder einen Arzt aber auch kaum zwingen gegen eigene Überzeugungen zu handeln. Der Patient sollte also im Rahmen seiner freien Arztwahl vor der Behandlung mit den Ärzten klären, ob seine Patientenverfügung akzeptiert wird bzw. welche Maßnahmen im Fall der Fälle durch die Ärzte mitgetragen werden. Dem Patienten obliegt die Entscheidung, wo er behandelt werden will. Notfalls kann auch eine Verlegung erfolgen. Möglich ist auch die Anrufung der Gerichte mit dem Ziel der Feststellung, ob der Patientenwille umzusetzen ist.
Apropos verlegen. Sind die Krankenhäuser verpflichtet, die Patienten zu verlegen, wenn die "Konkurrenz"-Klinik besser helfen kann?
Glaser: Das Krankenhaus muss sicherstellen, dass die Behandlung nach dem zum Zeitpunkt der Behandlung geltenden Facharztstandart erfolgt. Ist es dazu aus personellen oder Ausstattungsgründen nicht in der Lage, sollte es - zur Vermeidung von möglichen Behandlungsfehlervorwürfen - die Möglichkeit einer Verlegung prüfen. Es gibt z.B. Schwerpunktkrankenhäuser für Spezialbereiche (Herzerkrankungen, Kinderintensivstationen usw.). Dem Patienten muss immer so geholfen werden, wie es erforderlich ist. Zu prüfen ist aber auch, ob eine Verlegung nach dem Zustand des Patienten überhaupt möglich ist.