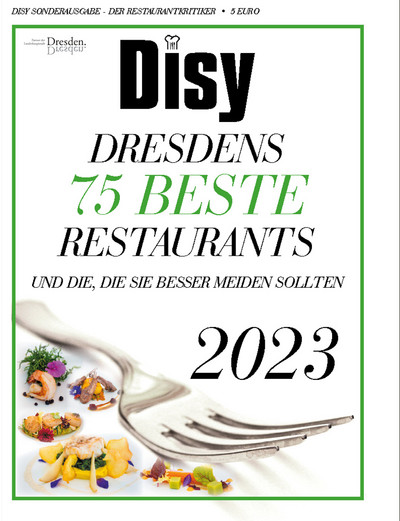- 3933 Aufrufe
Stammzellen und Biomaterialien ersetzen das erkrankte Zell-Milieu
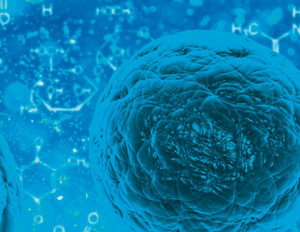
Neuroregenerative Therapien bringen verloren gegangene Zellfunktionen zurück. Die neusten Erkenntnisse aus Dresden
Stammzellen sind die neuen Hoffnungsträger vieler zukünftiger Therapien. Durch Regeneration sollen defekte Nervenzellen ersetzt und neurologische Erkankungen kuriert werden. Dabei gibt es verschiedene Ansätze, von der Transplantation bis zur Biomatrix. Langfristig könnte eine Krankheit mit defekten oder abgestorbenen Nervenzellen damit nicht mehr nur in ihren Symptomen, sondern in der Ursache behandelt werden. Disy sprach darüber mit Prof. Dr. med. habil. Alexander Storch, Professor für Neurodegie mit Schwerpunkt Neurodegenerative Erkrankungen an der TU Dresden und stellv. Direktor der Klinik und Poliklinik für Neurologie an der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus.
Wie kann man Stammzellen bei der Therapie einsetzen?
Prof. Storch: Regenerative Therapien befassen sich mit der Wiederherstellung zerstörter oder nicht funktionsfähiger Zellen. Die Ursache einiger Erkrankungen ist der Verlust der Nervenzellen, bei Parkinson sind es beispielsweise die, die den Botenstoff Dopamin produzieren. Als Symptome entstehen Störungen der motorischen Kontrolle. Für restaurative Therapien gibt es dann drei grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten. Ein Ansatz ist es, die Zellen durch Transplantation zu ersetzen.
Dabei werden gesunde Zellen auf einen Patienten übertragen?
Prof. Storch: So ist es im Grunde gedacht. Seit den 80er Jahren gab es weltweit Studien, die dafür embryonale Zellen aus Fehlgeburten verwendeten. Sie konnten zeigen, dass die Zellen anwachsen und funktionstüchtig sind, trotzdem war der Nutzen immer noch nicht effektiv genug. Ein Problem, das sich ergab, war, dass die Erkrankung in der Folge auch die transplantierten Zellen befallen hat. Das bessere Überleben und die Effizienz sind also wichtige Ansatzpunkte.
Wie könnte man das erreichen?
Prof. Storch: Tests im Labor in dieser Hinsicht werden mittlerweile mit Stammzellen durchgeführt und nicht mehr mit Zellen aus Aborten. Wir können diese heute in großen Mengen herstellen und die Zellen so generieren, dass sie besser überleben. Bei den Zellen aus Fehlgeburten verhielt es sich ähnlich wie mit Spenderorganen: Häufig gibt es nicht die Zeit für gründliche Qualitätsprüfungen. In der Regel wurde bei den Zellen nicht einmal der gesunde Chromosomensatz getestet. Ähnlich verhält es sich mit der Untersuchung auf Immunfaktoren oder Infektionen wie Hepatitis und HIV. Die Stammzellen, die wir im Labor herstellen, sind im Detail kontrollierbar, und wir können aus ihnen mittlerweile ganz gezielt Nervenzellen differenzieren. Eine zusätzliche Herausforderung ist, dass die Abstoßungsreaktion von Spenderzellen im Gehirn noch weitgehend unerforscht ist. Aus diesem Grund ist vor allem ein autologer Ansatz attraktiv.
Das wäre also eine Eigenspende des Patienten?
Prof. Storch: Richtig, bei Knochenmarktransplantationen wird das heute schon routinemäßig durchgeführt. Dabei entnimmt man zum Teil krankes Gewebe und reinigt es von zerstörten bzw. kranken Zellen. Im Fall der Parkinson-Erkrankung können wir allerdings keine Nervenzellen entnehmen, da sie im Gehirn extrem weitläufig und dicht vernetzt sind, daher ersetzen wir sie durch Hautzellen oder Bindegewebszellen.
Wie können Hautzellen Nervenzellen ersetzen?
Prof. Storch: Durch Reprogrammierung bringen wir sie zurück in ein undifferenziertes, sozusagen "rohes" Stadium. Man nennt sie dann induzierte pluripotente Stammzellen oder auch IPS-Zellen. Aus ihnen lassen sich alle Zelltypen entwickeln, sie fungieren sozusagen als ein Ersatzteillager. Durch die Einwilligung des Patienten gibt es auch keine ethischen Probleme wie bei der Arbeit mit embryonalen Stammzellen. Allerdings besitzen auch diese Zellen die genetischen Veranlagungen des Erkrankten. Bei den meisten Fällen wissen wir nicht, wie die Gene aussehen, die Parkinson hervorrufen können, aber für fünf bis zehn Prozent sind sie bekannt und über eine Genkorrektur könnten kleine Defekte umgeschrieben werden. Für diese Patienten ist die Methode somit besonders attraktiv. Tests am Tiermodell haben gut funktioniert und in Amerika soll es bald Studien zu dieser Therapie geben. Allerdings muss man bedenken, dass diese IPS-Zellen sehr potent sind und sich durchaus auch zu Tumorzellen entwickeln könnten. Diese Möglichkeit muss man eigentlich ausschließen, bevor man solche Therapien zulässt. Die Transplantation erfolgt außerdem heterotop, also an eine andere Stelle als den Ort, wo die ursprünglich erkrankten Zellen liegen. Der Grund dafür sind die günstigeren synaptischen Kontakte, die im Gehirn die Nervenzellen zu sehr komplexen Netzwerken verbinden.
Also wird das neue Dopamin dann an anderer Stelle produziert und dem Gehirn zugeführt?
Prof. Storch: Nein, die gesunden Zellen werden in das Striatum eingebracht, also dem Teil des Gehirns in dem die Ausläufer der erkrankten Nervenbahnen liegen. Damit wird der Botenstoff Dopamin dort produziert und freigesetzt, wo er gebraucht wird. Damit liegen die neuen Nervenzellen aber nicht in ihrem ursprünglichem Gehrinareal (der Substantia nigra) und können sich somit nicht in ihre ursprünglichen Schaltkreise integrieren. Diese Zellen können dann nicht mehr korrekt kommunizieren. Auf diese Art kann es zu einer gestörten Wirksamkeit, aber auch zu einer höheren Zellsterblichkeit im Transplantat kommen. Um das zu verhindern, kombinieren wir die Zellen mit Biomaterialien, die die Wachstumsfaktoren der fehlenden Nachbarzellen ersetzen sollen. Man nennt das Neural Tissue Engineering. Das Max Bergmann Zentrum in Dresden liefert uns dabei die Biomaterialien, also Werkstoffe und Gele, die den Zellen helfen sollen, sich zu integrieren und so das Gewebe wieder aufzubauen. Wir testen das derzeit in Zellkulturen.
Was für Biomaterialien kommen dafür in Frage?
Prof. Storch: Zum Beispiel Polyethylenglykole. Diese bilden sternförmige Moleküle, die eine bessere Vernetzung ermöglichen. Ihre physikalischen Eigenschaften kann man sehr gut einstellen, zum Beispiel die Elastizität oder ph-Beständigkeit. Die biologischen Faktoren werden an diese Matrix angebaut und bauen zusammen mit den Stammzellen ein Stück des Gehirns nach. Mittlerweile kann man diese Gele sogar flüssig injizieren, im Gewebe härten sie dann aus. Der Vorteil ist, dass es bei diesem neuen Gewebe wohl keine Immunreaktionen gibt. Wir geben den Zellen bei der Injektion dann Überlebensfaktoren mit, und so finden sie selbst den Weg vom Ursprung zur Zielstelle.
»Bei der Neurotransplantation gab es häufig keine gründlichen Qualitätsprüfungen der Zellen.«
Sie sprachen von zwei weiteren Ansätzen. Wie weit sind diese inzwischen?
Prof. Storch: Es wurde nachgewiesen, dass auch das Erwachsenengehirn noch Stamm- und Vorläuferzellen besitzt. Nervenzellen können sich normalerweise nicht mehr teilen, aber sie bilden sich an einigen Stellen neu - wahrscheinlich ist das essentiell für das Gedächtnis. Die eine Idee ist daher, diese Stammzellen zu verwenden, um verlorengegangene Zellen zu ersetzen. Wir können heute die Vermehrung, Auswanderung und Entwicklung zu Nervenzellen beeinflussen. Im Hinblick auf Parkinson-Therapien funktioniert das aber im Moment noch nicht, einfacher wäre es zum Beispiel bei Schlaganfall-Patienten. In einer Studie wird derzeit zum Beispiel der Wachstumsfaktor "PDGF-BB " von der Firma Neuronova Schweden getestet, den man direkt ins Gehirn gibt. Wie genau dieser Faktor funktioniert, ist gar nicht bekannt, aber wir testen eine ganze Reihe solcher Substanzen im Labor, in der Hoffnung, welche zu finden, die die reparative Wirkung besitzen, die wir brauchen.
Also gibt es einen Transplatationsansatz und den, eigene Stammzellen zu aktivieren. Was kann man noch versuchen?
Prof. Storch: Die dritte Möglichkeit bezieht sich auf das Mikromilieu der Zellen, also das die erkrankten Nerven umgebende Gewebe. Wir wollen erreichen, für die erkrankten Zellen eine optimale Umgebung zu schaffen, mit dem Ziel, dass sie sich auf diese Weise erholen können. Das kann man mit Biomaterialien schaffen oder mit Zellen, die sich dort ansiedeln und Wachstumsfaktoren abgeben, die die dopaminergen Zellen schützen oder positiv beeinflussen. Wir stellen also Zellen her, die diese Faktoren produzieren und transplantieren sie. Das Problem mit dem Absterben der Zellen bei Parkinson bezieht sich möglicherweise gar nicht nur auf die Dopamin-herstellenden Zellen, sondern vor allem auf das umgebende Gewebe, sodass sie nicht mehr vernünftig arbeiten können. Solche abgeschotteten Zellen können auch nicht mehr korrekt kommunizieren.
Wie schätzen Sie die Perspektive dieser Ansätze ein?
Prof. Storch: Alle gennannten Therapieanstze befinden sich im experimentellen Stadium und werden derzeit nicht in klinischen Studien untersucht. Langfristig ist das Ziel, die erkrankten Zellen selbst, also deren Absterben, zu therapieren und nicht länger nur die Symptome zu behandeln. Im Moment ist es aber wichtig, überhaupt erst Substanzen zu finden, die das beeinflussen können. In zehn oder zwanzig Jahren ist das vielleicht sogar so weit nutzbar, dass jeder Patient seine individuellen Medikamente bekommen kann, je nachdem, was die Zellen brauchen. Zurzeit sind die Therapien aber noch nicht ausreichend im Labor untersucht und zu risikoreich, um sie bei Parkinson-Patienten anzuwenden. Es gibt aber daneben auch Erkrankungen, die aggressiver und schneller voranschreiten, dort wäre man auch eher bereit, ein höheres Risiko einzugehen.
So kann man kurzfristig auch bei anderen Krankheiten Erfolge erzielen?
Prof. Storch: Es gibt zum Beispiel eine kindliche Erkrankung des Nervensystems, die Neuronale Ceroidlipofuszinose heißt; dabei erkranken Kinder durch einen Gendefekt und sterben innerhalb von wenigen Jahren. Wenn man diesen Patienten helfen könnte, wäre das schon ein großer Schritt. Die IPS-Zellen lassen sich möglicherweise dafür einsetzen und bilden ein fehlendes Enzym im Gehirn nach, das sich dann gleichmäßig verbreitet. Wir arbeiten in dieser Hinsicht mit der Neuropädiatrie zusammen, um neue Heilungsmethoden zu erforschen, und wir haben am Uniklinikum Dresden ein Zentrum für seltene Erkrankungen gegründet, bei dem Ärzte verschiedener Bereiche zusammen arbeiten und auch neue Therapien entwickeln. Die Symptome gehen in alle Richtungen, die Kinder erblinden beispielsweise und ihre Bewegungen sind gestört, gleichzeitig brauchen sie oft auch psychologische Betreuung. Mein Schwerpunkt als Erwachsenenneurologe ist die Parkinson`sche Erkrankung, und auf dem Weg zu unserem Ziel, die Krankheit zu heilen, werden wir schon sehr viel lernen. Aber die echte Anwendung wird länger dauern als vielleicht bei den Kindererkrankungen, wo das Nutzen-Risiko-Verhältnis im Vergleich wesentlich besser liegt.
Prof. Dr. med. habil. Alexander Storch

Alexander Storch studierte an den Universitäten Mainz und Berlin und habilitierte in Ulm im Fachbereich Neurologie. Heute ist er Professor für Neurodegie mit Schwerpunkt Neurodegenerative Erkrankungen an der TU Dresden und stellv. Direktor der Klinik und Poliklinik für Neurologie an der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus. Außerdem ist Vorstandsmitglied im DFGForschungszentrum und Exzellencluster "Center for Regenerative Therapies Dresden (CRTD)". Seit 2011 ist er zudem Arbeitsgruppenleiter am neu gegründeten Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) Dresden.