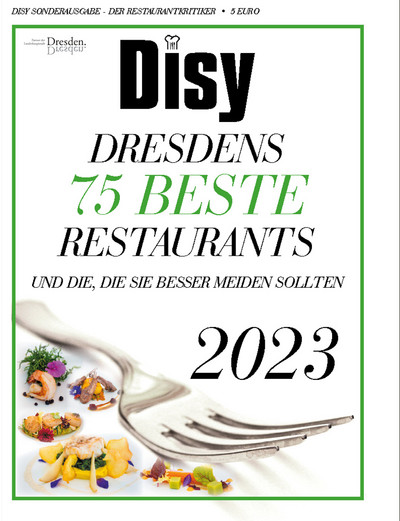- 3974 Aufrufe
In Dresden-Friedrichstadt verbindet man Allergieforschung mit der Untersuchung von Hautkrankheiten

Kritische Veränderungen der Haut und allergische Reaktionen werden immer mehr Thema unserer Gesellschaft. Professor Uwe Wollina ist Dermatologe und Allergologe am Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt und legt besonderen Wert auf interdisziplinäre Zusammenarbeit, bei der neue Methoden entstehen, die den gefährlichen Trend-Erkrankungen den Kampf ansagen.
In Ihrer Klinik verbinden Sie die Dermatologie mit der Allergologie – wird das überall so gehandhabt?
Prof. Wollina: Das ist nicht in allen Häusern so, aber es kommt häufig vor. Bei uns bilden Allergien gegen Wespen- und Bienengift den Schwerpunkt, die ja auch über die Haut in den Körper kommen. Im Vergleich ist die Wespe dabei stärker vertreten, weil Wespen stechfreudiger als Bienen sind, aber beide Insektengiftallergien sind deshalb so wichtig, weil es da zu lebensbedrohlichen Auswirkungen kommen kann.
Was können Sie dagegen tun?
Prof. Wollina: Wir bieten dafür eine spezifische Immuntherapie an, bei der ein wirksamer Schutz erzeugt wird, sodass ein Stich ohne schlimmere Folgen vertragen werden kann. Diese Behandlung ist sehr zeitaufwendig und wird stationär eingeleitet, weil zu Beginn eine Überwachung über 24 Stunden erfolgen muss. Daher wird die Therapie auch nicht von Arztpraxen abgedeckt und wir haben hier unsere Nische gefunden.
Wie läuft so eine Therapie ab?
Prof. Wollina: Natürlich müssen wir zunächst die Art der Allergie diagnostizieren. Es gibt neben Wespengift- und Bienengift- auch kombinierte Allergien oder solche, die andere stechende Insekten betreffen – wie zum Beispiel die Hummel oder die Hornisse. Ist das genau abgeklärt, wird das entsprechende Gift ausgewählt. Die Behandlung sieht dann grob so aus, dass man sich von kleinen Dosen bis hin zu größeren Mengen vorarbeitet und diese unter die Haut in die Muskulatur injiziert, wo sie eine schwache Reaktion des Immunsystems hervorrufen. Dabei entwickelt der Körper aktiv eine Toleranz – während er bei einem Stich, also einer höheren Dosis, mit Abwehr reagieren würde. So eine Toleranzentwicklung braucht aber meist mehrere Zyklen und erstreckt sich über einen Zeitraum von drei bis vier Jahren. Es gibt aber auch Menschen, die seltene andere Erkrankungen des Knochenmarks haben, und wo man lebenslang immunisieren muss – aber das ist die Ausnahme.
Warum sind manche Allergien lebensbedrohlich und andere nicht?
Prof. Wollina: Eine lokale Reaktion bei einem Stich bekommt jeder Mensch, also eine Rötung und eine leichte Schwellung, was aber harmlos ist. Es gibt jedoch Patienten, die mehr als eine lokale Reaktion bekommen. Beispielsweise reagiert dann der Kreislauf; das Herz schlägt schneller, es kommt zu Ausschlag am ganzen Körper, Schwindelgefühl, Atemnot oder auch Ohnmacht. Das sind schwerere Formen, die wir in unserer Klinik behandeln.
Wie ist Ihre dermatologische Abteilung in Dresden positioniert, wenn man sie mit anderen vergleicht?
Prof. Wollina: Unser Haus ist von seiner Geschichte her eine der ältesten Hautkliniken außerhalb der Universität. Im letzten Jahr haben wir unser 165. Jubiläum gefeiert. Bei den städtischen Dresdner Krankenhäusern gibt es die Dermatologie nur in der Friedrichstadt. Die Klinik gehört zu den großen im Osten Deutschlands. Unsere Behandlungszahlen sind vergleichbar mit denen der beiden großen sächsischen Universitätskliniken oder Häusern wie in Zwickau und Chemnitz.
Da blicken Sie auf eine lange Tradition zurück ...
Prof. Wollina: Das stimmt. Die Gründung des Krankenhauses Friedrichstadt war ursprünglich eine Folge der 1948er Revolution. Für die Verletzten der Barrikadenkämpfe hat man damals ein Lazarett gebraucht, und dieses Gelände – was ursprünglich dem Grafen Marcolini gehörte – war zu der Zeit ungenutzt. Da- her hat die Stadt die Fläche übernommen und zunächst ein Notkrankenhaus und später das städtische Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt erbaut. Heute reicht unser Einzugsgebiet sogar weit über Sachsen hinaus, bis nach Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und ins Bayrische Vogtland.
Gibt es dort zu wenig Kliniken oder sind Sie hier so spezialisiert?
Prof. Wollina: Es gibt zwar Kliniken, aber wir haben einige Spezialisierungen, sodass die Patienten den weiteren Weg gerne auf sich nehmen. Die Hautklinik ist bei uns als selbstständige Klinik aus der inneren und aus der plastischen Chirurgie entstanden – gerade die plastische Chirurgie hat in Dresden-Friedrichstadt eine sehr lange Tradition. Das erklärt auch, weshalb, die Dermatochirurgie hier einen besonderen Stellenwert einnimmt. Heute haben wir hier einmal eine Zuweisungssprechstunde vom niedergelassenen Hautarzt, dann die allergologische Sprechstunde und zwei weitere Strukturen: Einmal die Tagesklinik, wo wir überwiegend Patienten mit Hauttumoren behandeln, und natürlich unsere Station. Auch dort spielen die Hauttumoren eine große Rolle, aber auch schwere Erkrankungen aus dem Bereich Neurodermitis, Schuppenflechte, Autoimmunerkrankungen oder auch gefäßbedingte Erkrankungen der Haut.
Wie häufig kommen die Hauttumoren vor?
Prof. Wollina: Bösartige Tumoren, also Hautkrebs, bilden einen wesentlichen Schwerpunkt des stationären Bereichs. Einerseits sind es die häufigsten bösartigen Tumoren des Menschen überhaupt, andererseits haben wir heute auch ein sehr vielfältiges Spektrum von Behandlungsmöglichkeiten. Die häufigste Form der Erstbehandlung ist die Operation und wir führen hier etwa 1.500 bis 2.000 solche Hautoperationen pro Jahr durch – in den meisten Fällen beim weißen Hautkrebs. Daneben gibt es noch den schwarzen Hautkrebs, also das Melanom. Für die Melanombehandlung haben wir hier auch ein Zentrum und bieten dafür eine spezialisierte Diagnostik an.
Wie sieht diese Diagnostik aus?
Prof. Wollina: Dabei geht es zum Einen um die Untersuchung des so genannten Schildwächterlymphknotens, auch Sentinel genannt. Das ist der Lymphknoten, der dem Tumor am nächsten liegt und wie eine Rheuse vorbeiströmende Tumorzellen abfiltert. Durch spezielle Verfahren kann man diesen Lymphknoten sichtbar machen, zum Beispiel mit der Nuklearmedizin unter Zusatz eines Farbstoffs. Dann kann dieser Lymphknoten bei einer Operation gezielt entnommen werden. Dieser Knoten ist nicht vergrößert, erscheint also gesund, aber wir entfernen ihn selektiv, um zu sehen, wie aggressiv der Tumor ist. Bei einem Teil der Patienten finden sich tatsächlich Tumorzellen in diesem Lymphknoten, ohne das mit irgendeiner anderen Methode ein Nachweis einer solchen Streuung erfolgen könnte. Dieses Vorgehen ist also außerordentlich empfindlich im Nachweis des Ausbreitungspotentials des Melanoms – und zwar bevor klinische Symptome auftreten oder wir etwas mit Röntgen, CT oder MRT nachweisen können.
Was hat das zur Folge?
Prof. Wollina: Ein großer Vorteil ist, dass wir vielen Patienten dadurch eine umfangreiche Lymphknotenentfernung ersparen können. Außerdem haben wir eigene Untersuchungen gemacht, in denen wir die Daten über zehn Jahre ausgewertet haben, und dabei nachgewiesen, dass Patienten, die eine solche Sentinellymphknotenbiopsie bekommen, eine bessere Prognose haben als solche, bei denen man es nicht macht. Man sieht, dass die Zeit bis zum Auftreten einer möglichen Metastase deutlich länger ist, aber auch, dass das Gesamtüberleben sich verbessert. Bei diesem Verfahren zeigt sich außerdem, dass wir in unserer Klinik sehr darum bemüht sind, mit anderen Fachdisziplinen zusammenzuarbeiten, für diese Methode brauchen wir beispielsweise Nuklearmediziner und Narkoseärzte, für die Aufarbeitung des Gewebes auch die Pathologie. Diese Wechselwirkungen mit den anderen Fachdisziplinen sind für uns wichtig.
Wie sieht es mit der Vorsorge aus?
Prof. Wollina: Patienten, die schon ein Melanom hatten oder einer besonderen Risikogruppe angehören, bieten wir eine in Deutschland einmalige Früherkennungsmethode mithilfe der objektiven Bildbearbeitung an. In der Vorsorge wird häufig nur das Auge des Untersuchers oder ein Handmikroskop, beziehungsweise Dermatoskop, eingesetzt. Alles, was damit untersucht wird, ist dem subjektiven Blick des Arztes unterlegen. Was man gesehen hat, kann man normalerweise nicht festhalten und vergleichen, auch der Patient kann nicht unbedingt mit hineinsehen. Was wir hier nutzen, ist ein System, das eine besondere Lichtquelle verwendet – so genanntes polarisiertes Licht. Dazu kommen eine Kamera und ein spezielles Computerprogramm, das auf eine große Datenmenge von Pigmentveränderungen zurückgreifen kann, die auch vom Pathologen untersucht worden sind. Wir haben also die Möglichkeit, eine Veränderung mit einem großen Datensatz analysierter Tumore zu vergleichen und daraus eine Schlussfolgerung auf das Risiko zu ziehen.
Ist das einzigartig?
Prof. Wollina: Ja, diese so genannte DBMIPS-Technologie wurde in Italien entwickelt und ist weltweit in Zentren vertreten – in Deutschland eben nur bei uns. Es ist die einzige Möglichkeit, mit der man in multizentrischen Studien Verlässlichkeit und Empfindlichkeit untersucht hat. Ein digitales Bild zu machen, ist heute keine große Kunst mehr, aber diese Analyse auf dem heute höchstmöglichen Niveau bieten derzeit nur diese Geräte mit der Software. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir das unseren Patienten hier anbieten können.
Wie sind Sie dazu gekommen, das in Dresden anzubieten?
Prof. Wollina: Es ist wie oft im Leben gewesen: Ich habe auf einem internationalen Kongress die Entwickler getroffen, als ich 2001 die Aufstellung des Gerätes in Prag begleitet habe. Damals war ich von der Gerätetechnik fasziniert und habe mir gesagt, dass wir das für unsere Patienten unbedingt brauchen, weil es uns hilft, sie vor unnötigen Operationen zu bewahren.
War das damals das erste Gerät von seiner Art?
Prof. Wollina: Nein, die Kollegen hatten schon 20 Jahre Vorarbeit geleistet. Die ersten Vorläufer gab es bereits Ende der 70er Jahre; die Entwicklung wurde damals an der Universität von Florenz be- sonders gefördert und ist ebenfalls das Ergebnis einer interdisziplinäen Zusammenarbeit von Medizinern und Softwareentwicklern. Die letzte Generation des Geräts, die wir aktuell nutzen, ist von 2014.
Forschen Sie auch mit dieser Technologie?
Prof. Wollina: Es gab jetzt erst eine Studie: Mit Unterstützung des Sächsischen Ministeriums für Soziales und Verbraucherschutz haben wir dieses Gerät schon für eine Vorsorgeuntersuchung in Dresdner Kindertagesstätten genutzt. Diese Untersuchungen wurden im Rahmen des Projekts „Gesunde Sachsen“ gefördert. Ab dem Eintritt in die Kita haben wir Kinder drei Jahre lang mit diesem Gerät untersucht und begleitet. In dieser Zeit haben wir über 7.000 Pigmentmale analysiert; unser Ziel war es dabei, zu sehen, ob es erstens heute ein erhöhtes Expositionsrisiko zur ultravioletten Strahlung gibt und ob zweitens durch Aufklärung der Eltern ein zusätzlicher Schutzeffekt für die Kinder erzielt werden kann. Dazu haben wir für eine Gruppe neben den Untersuchungen zusätzliche Elternabende angeboten, in denen sie über Sonnenschutz, Lichtschutzpräparate und Lichtschäden aufgeklärt wurden. Unsere Ausgangsbasis für die Statistik war eine große Studie, die in Norddeutschland Anfang der 2000er Jahre druchgeführt und 2005 veröffentlicht wurde. Dabei sind über 1.000 Kinder in der gleichen Altersgruppe untersucht wurden und man hat im Alter von drei Jahren im Durchschnitt vier Pigmentmale gesehen und im Alter von sechs Jahren schon acht – also doppelt so viele.
Und wie sehen Ihre Ergebnisse aus?
Prof. Wollina: Die Ausgangszahlen waren bei uns gleich, aber am Ende der Studie war die Durchschnittspigmentzahl 20! Das ist eine ziemlich starke Entwicklung. Dazu muss man sagen, dass die Menschen im Norden noch stärker an die See gehen, also ist die Intensität der Besonnung viel größer als im Inland, weil es Reflexionen im Sand und im Wasser gibt, die auch auf mehr freie Haut treffen. Woher kommt das also? Wir glauben, dass der größte Teil dieser Pigmentierung durch die Besonnung während des Jahresurlaubs entsteht. Während in der Kita immer darauf geachtet wurde, dass ein Sonnenschutz besteht, war das im Urlaub nicht ganz so konsequent. Auch unser Versuch, die Eltern über den Arzt aufzuklären, brachte keinen Erfolg. Die Studie, die wir im letzten Jahr publiziert haben, ist deshalb so bemerkenswert, weil sie weltweit zum ersten Mal objektive Messgrößen für die Beurteilung der Pigmentveränderungen verwendet hat. Positiv kann man anmerken, dass keine auffälligen Pigmentmale aufgetreten sind, die man hätte entfernen müssen. Trotzdem ist die Zahl der Zunahme der Male in diesem Kleinkindalter ein direktes Maß der UV-Bestrahlung. Die Entstehung dieser Veränderungen zeigt uns, dass der Lichtschutz große Lücken hat.
Sind solche Untersuchungen aufwendig?
Prof. Wollina: Das kann man nicht eben nebenbei bewältigen. Die Studie war mit hohem organisatorischen Aufwand verbunden, beispielsweise durch die Aufklärung der Kitas und der Eltern. Für die Analyse der Pigmentmale haben wir pro Hautveränderung etwa 65 Parameter ausgewertet – das reicht von Größe, Farbgebung und Farbdichte bis hin zur Regelmäßigkeit der Ränder. Auch für den Statistiker ist das sozusagen ziemlich viel Arbeit.
Im Fall der bösartigen Veränderungen wäre dann die OP die Methode der Wahl?
Prof. Wollina: Ja, die Therapie beginnt in der Regel schon mit der Entfernung. In Zeiträumen von zehn Jahren haben wir für Melanome unter einem Millimeter Dicke heute Heilungsraten, die zwischen 98 und 99 Prozent liegen. Wenn man also die Vorsorgemöglichkeiten nutzt, die jedem gesetzlich Versicherten zur Verfügung stehen, und vernünftig mit der Sonne umgeht, hat man also gute Aussichten, auch beim Auftreten eines Tumors, diesen sehr frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. Die Patienten profitieren dann von der Früherkennung, indem ihnen andere aufwendige Therapiemethoden, wie Chemo oder Strahlentherapie, erspart bleiben. Der große Vorteil ist einfach, dass sich die Haut dem Betrachter darbietet – im Vergleich zu Tumoren im Inneren des Körpers haben wir direkte Informationen, während man dort häufig nicht hinschau- en kann. Leider beobachten wir eine unterschiedliche Nutzung der Vorsorgeangebote: Männer sind da gemein- hin sehr träge und zurückhaltend, während Frauen mehr bemüht sind und zum Beispiel auch Informationsveranstaltungen besuchen.
Vielen Dank Prof. Dr. Wollina!