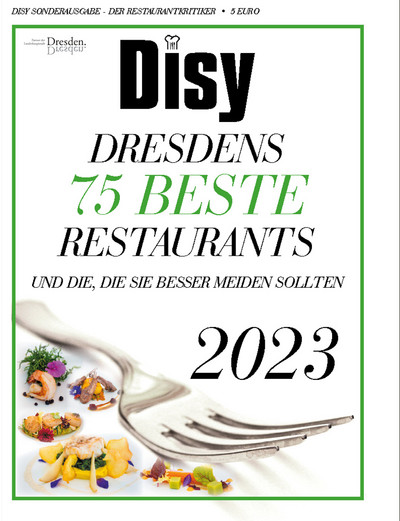- 3620 Aufrufe
Die Vielfalt des Alterns - Gedanken über neue Herausforderungen in unserer Gesellschaft von Bundespräsident Gauck Teil 2

Über die Vor- und Nachteile einer immer älter werdenden Bevölkerung lässt sich streiten. Denn was auf der einen Seite für eine erfolgreiche, medizinische und menschliche Versorgung spricht, bringt auf der anderen Seite auch Probleme mit sich. In Teil 2 unseres Interviews mit Joachim Gauck erklärt der Bundespräsident wie die Politik die Probleme unserer Gesellschaft angehen sollte.
Sind wir als Gesellschaft bereit, für die große Bandbreite an Möglichkeiten im Alter eine entsprechend große Bandbreite an Gestaltungsoptionen vorzuhalten?
Im Koalitionsvertrag von 2013 wurde notiert: „Ältere Beschäftige sind unverzichtbar im Arbeitsleben. [...] Wir werden den rechtlichen Rahmen für flexiblere Übergänge vom Erwerbsleben in den Ruhestand verbessern“.
Die Legislaturperiode ist bekanntlich noch lange nicht zu Ende. Ich fürchte allerdings, dass die Diskussion über dieses Thema allzu schleppend verläuft und der nötige Wandel der Arbeitswelt noch nicht entschlossen genug vorangetrieben wird. Dabei betrifft diese Aufgabe uns alle: die Bürgerinnen und Bürger, die Gemeinde- und Landespolitiker, vor allem aber den Bundesgesetzgeber und die Tarifpartner als Gestalter der wichtigsten Altersgrenze – des Eintritts in die Rente. In Deutschland ist die gesetzliche Rente bislang ausgerichtet, ein Ende zu definieren, keinen Übergang. In anderen Ländern gibt es durchaus offenere Konzepte. Deutschland steht hier noch am Anfang der Debatte.
Immerhin, es liegen einige konkrete Vorschläge auf dem Tisch, beispielsweise eine Version von Teilzeit, in diesem Fall für Alte. Fünfzig oder siebzig Prozent der üblichen Wochenarbeitszeit könnten für beide Seiten ein Gewinn sein: Der Arbeitgeber profitiert von der Reife und der Urteilskraft der Älteren. Der Arbeitnehmer leistet so viele Stunden, wie er möchte und seine Gesundheit oder seine anderen Vorhaben, etwa die Betreuung der Enkelkinder, es zulassen. Flexible Renteneintrittsgrenzen und unser Sozialstaatsprinzip müssen kein Widerspruch sein. Auch hier sind uns althergebrachte Bilder noch im Wege. Die Vorstellung von der Arbeit als Last stammt oft noch aus frühen Phasen der Industriegesellschaft, als schwerste körperliche Arbeit die Regel war. Wo dies auch heute noch gilt – auch heute gibt es ja noch diese Form der Arbeit –, wo also in der Industrie oder etwa im Pflegebereich Menschen an ihre körperlichen Grenzen kommen, da sind sie tatsächlich zu schützen und wirksam zu entlasten. Andererseits kennen wir heute, in der Wissensgesellschaft mit ihren so veränderten Arbeitsbedingungen auch in industriellen Bereichen, eine Vielzahl von Arbeitsplätzen, die im Alter nicht als Bürde empfunden werden, sondern als gewünschte Fortsetzung eines aktiven, selbstbestimmten Lebens.
Deshalb möchte ich dazu einladen, umzudenken und dem gewandelten Lebensgefühl vieler Menschen besser Rechnung zu tragen. Was wir brauchen, ist eine neue Lebenslaufpolitik!
Der Staat steht in der Pflicht, die ganze Bandbreite von denkbaren Szenarien im Alter zu berücksichtigen. Es geht also einerseits darum, Menschen vor Überforderung zu schützen, andererseits auch darum, jenen, die es wollen, Möglichkeiten zu eröffnen, sich einzubringen.
Alle Politikfelder sind deshalb gefordert. Bildung und Arbeit habe ich schon genannt, Gesundheit, Wohnen, Infrastruktur und viele weitere müsste man hinzufügen. Wir werden dem demographischen Wandel nur gerecht, wenn wir uns der Komplexität der Aufgabe stellen und wenn wir lernen, politisch in größeren Zeiträumen zu denken, nicht nur in Legislaturperioden. Man könnte es auch so formulieren: Eine Gesellschaft des längeren Lebens braucht eine Politik des längeren Atems!
Unsere Gesellschaft braucht in meinen Augen noch etwas anderes: enge persönliche Beziehungen. und zwar zwischen den Menschen der unterschiedlichen Altersgruppen. Nur wenn sich Alt und Jung begegnen und nicht voneinander absondern, können wir einen der schwierigsten Dialoge führen: das Gespräch über längeres Leben und die dennoch unausweichliche Endlichkeit unserer Existenz. Aus meiner früheren Arbeit als Seelsorger weiß ich, wie sehr es Menschen belasten kann, wenn sie sich in ihren letzten Jahren nur noch als hilfsbedürftig, nur noch als passiv empfinden. Und wie kostbar für sie der Augenblick ist, in dem sie sagen können: „Ich habe bis zum Schluss getan, was ich konnte. Ich habe mein Leben gelebt“. So heißt es dann, wenn sie ihre Fähigkeiten bis in ihre alten Tage einbringen konnten. Das ist ein Ja zum Leben, auch in einer Phase, wo manchen das Ja schwer fällt. Selbstbestimmung im hohen Alter ist ein unschätzbares Gut. Wir sollten die Selbstbestimmung fördern, wo immer wir können. Zugleich gilt jedoch: Der Mensch verliert seinen Wert und seine Würde nicht, wenn er nicht mehr autonom handeln und entscheiden kann, sondern auf andere angewiesen ist. Mir fällt gerade ein, dass ich gestern einen Film gesehen habe, wo es um einen Menschen ging, der in eine Demenz geriet, und wie schwierig es war, ihm in diesem Zustand die eigene Würde und Selbstbestimmtheit zuzuerkennen. Offensichtlich war auch, wie sehr die alten Bilder von beeinträchtigten Menschen uns prägen. Oft ist der Gesetzgeber da schon weiter als die Mentalität der Menschen.
Ich war eben bei der Hilflosigkeit stehen geblieben. Ja, die gibt es. Aber vielleicht können wir diese Hilflosigkeit besser ertragen, wenn wir uns eingestehen: Jeder Mensch ist in zwei Phasen des Lebens auf besondere Unterstützung der Gemeinschaft angewiesen – ganz zu Beginn und ganz zum Schluss. Bei einem Neugeborenen fällt es uns leicht, die Abhängigkeit als etwas Natürliches und als natürliche Verpflichtung für das Umfeld zu begreifen. Dieses Selbstverständnis müssen wir für die letzte Phase des Lebens erst noch erringen – jeder für sich und die Gesellschaft insgesamt. Auch wenn es uns schwerfällt: Ich begrüße es sehr, dass so sensible Themen inzwischen intensiver diskutiert werden. Ich habe selbst Kinder, Enkel und Urenkel. Schon um ihretwillen möchte ich Bundesgenosse all jener sein, die für einen Perspektivenwechsel und zugleich für einen Interessenausgleich der Generationen eintreten. Ich fürchte allerdings, dass der gern verwandte Begriff der Generationengerechtigkeit dabei in die Irre führen könnte. Denn auch in ihm schwingt ein Zerrbild mit, die Vorstellung vom Kampf um Gerechtigkeit. Davon sind wir heute glücklicherweise weit entfernt. Die familiären Beziehungen in Deutschland sind gut und belastbar. Eltern und Großeltern unterstützen ihre Kinder und ihre Enkel. Allerdings werden wir beweisen müssen, dass unsere Gesellschaft auch dann noch solidarisch bleibt, wenn sich das zahlenmäßige Verhältnis von Großeltern, Kindern und Enkeln weiter verändert – und das wird es. Wenn Interessen unter neuen Mehrheitsverhältnissen demokratisch auszuhandeln sind. Oder wenn immer mehr Alte auf Unterstützung jenseits der eigenen Familie angewiesen sind. Deshalb ist mir das Bild der Generationenbegegnung so wichtig, Generationenbegegnung und die Verständigung darüber, was wir voneinander erhoffen und erwarten, was wir voneinander wissen sollten und voneinander lernen könnten, nicht zuletzt, welche Konflikte wir austragen müssen.
Wer Anschauung sucht, für den gibt es Orte, an denen man viel lernen kann. Ich bin jüngst in Arnsberg gewesen, in Nordrhein- Westfalen. Dort stellt man sich mit Hilfe kommunaler Programme ganz gezielt auf die länger lebende Gesellschaft ein und übt den Generationendialog im Alltag. Das hat mir sehr imponiert. Gemeinsame Freizeitangebote, Nachbarschaftshilfe, alterssensibler Wohnungs- und Städtebau: All das funktioniert dort in Arnsberg und auch schon in vielen anderen Gemeinden, weil Politik, Unternehmen und Freiwillige sich zusammengetan und Ziele definiert haben, auch Konflikte aushandelt haben, und weil sie knappe Ressourcen nach klaren Prioritäten einsetzen. Dazu gehört zum Beispiel der Leitsatz, dass ehrenamtliches Engagement die nötigen hauptamtlichen Strukturen braucht, damit der gute Wille der einzelnen Freiwilligen nicht ins Leere läuft. Die „sorgende Gemeinschaft“ ist mir als Schlüsselbegriff von meinem Besuch in Arnsberg im Gedächtnis geblieben. Sie beschreibt ein Umdenken, das in immer mehr Kommunen stattfindet und das ich sehr befürworte. Es geht dabei nicht um irgendeine Spielart eines modernen Paternalismus, sondern um gemeinsam getragene Verantwortung in einer Zeit, in der sich Lebens- und Familienvorstellungen und -modelle stark ändern, in der wir neue Konzepte brauchen, um das Miteinander gedeihlich zu organisieren.
Wer diesen Begriff „sorgende Gemeinschaft“ konsequent zu Ende denkt, der muss auch über Chancengerechtigkeit im Alter sprechen. Auch die beginnt oder scheitert von klein auf. Wer arm ist – sei es an Bildung, sei es an Geld – hat nachweislich eine niedrigere Lebenserwartung. Derzeit beträgt die Differenz in Deutschland bis zu acht Jahre im Vergleich zu gebildeteren, wohlhabenderen Gruppen in der Gesellschaft. Acht Jahre! Das darf uns nicht gefallen. Die Gründe dafür sind vielschichtig. Die Konsequenz lässt sich für mich jedoch in einem Satz zusammenfassen: Wir müssen alles dafür tun, dass alle Menschen – egal in welche sozialen Umstände hinein sie geboren wurden – gute Chancen auf ein langes und gesundes Leben haben.