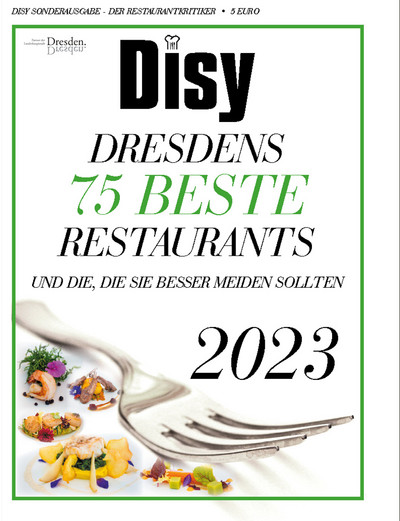- 3827 Aufrufe
Vom Roboter operiert

Neue Techniken ersparen Narben und machen Operationen sicherer
Operationen werden immer sicherer und effizienter. Mit einer speziellen robotergestützten Technik kann die Urologische Klinik des Dresdner Universitätsklinikums minimalinvasive Eingriffe vornehmen und gleichzeitig ausbilden. Doch nicht nur dieses Gerät hat den Operationssaal revolutioniert. Wir sprachen mit Prof. Dr. Manfred Wirth über die Vor- und Nachteile moderner Technologien im OP-Saal.
OP-Roboter klingen nach Science-Fiction. Wie oft kommen diese denn tatsächlich zum Einsatz?
Prof. Wirth: Der Roboter kommt täglich ein bis zweimal zum Einsatz, je nach dem.
Wie kann man sich eine robotergestützte OP vorstellen?
Prof. Wirth: Es ist eigentlich kein richtiger Roboter, denn er arbeitet nicht autark. Man könnte ihn eher als einen Mikromanipulator bezeichnen. Der Operateur sitzt an einer Konsole und steuert damit die Instrumente, die sich im Körper des Patienten befinden, millimetergenau. Diese Instrumente haben den Vorteil, dass sie wie eine Hand gebaut sind, während man bei der konventionellen Laparoskopie mit sehr starren langen Instrumenten arbeitet. Die Länge kann dann bis zu 40 oder 50 Zentimeter betragen.
Sie erwähnten den Ausschluss des Zitterns...
Prof. Wirth: Das ist eigentlich nicht so entscheidend. Wenn ich operiere, zittere ich auch nicht. Schneller ist der Roboter sowieso nicht, eher langsamer, weil die Vorbereitung so lange dauert.
Was sind dabei die größten Vorteile?
Prof. Wirth: Im Vergleich zur offenen OP ist eigentlich das Hauptargument, dass man viel kleinere Schnitte hat. Es gibt dann keinen Bauchschnitt mehr, weil der Roboter sozusagen "kleinere Hände" hat. Man kann daher Narben erheblich vermeiden oder verkleinern. Und die Freiheitsgrade im Vergleich zur konventionellen Laparoskopie sind auch entscheidend.
Welchen Unterschied macht das aus?
Prof. Wirth: Die Laparoskopie ist auch eine minimalinvasive Technik, die mit langen Instrumenten arbeitet, welche von außen bedient werden. Dabei hat man nur drei Freiheitsgrade, während man beim Roboter sieben besitzt, so wie bei der menschlichen Hand. Konventionell nutzt man also zum Beispiel eine Schere, die man vor- und zurückfahren und in der Höhe verändern kann, während beim Roboter auch ein Abwinkeln möglich ist, sodass man in alle Richtungen arbeiten kann. Außerdem vermeidet der Roboter das Zittern, das wird automatisch ausgeschaltet.
Wie genau bedient der Operateur den Roboter?
Prof. Wirth: Der Operateur sitzt an einer Konsole und hat zwei Instrumente in der Hand. Seine Bewegungen werden dann auf die Instrumente im Körper übertragen. Dabei kann er die Operation an einem Monitor verfolgen. Es gibt dort eine dreidimensionale vergrößerte optische Darstellung des gesamten Gewebes, was das Operieren erheblich erleichtert.
Wonach wird entschieden, ob der Roboter in der OP Verwendung findet?
Prof. Wirth: Das hängt von der Operation ab. Es gibt bestimmte Operationen, da eignet sich der Roboter sehr gut, dann bieten wir es den Patienten auch an. Das kann damit zusammenhängen, wo zum Beispiel bestimmte Tumoren liegen, an der Niere beispielsweise. Man muss auch beachten, ob Tumore klein oder groß sind. Bei sehr großen ist die Nutzung des Roboters nicht so sinnvoll.
Warum nicht?
Prof. Wirth: Die Entfernung großer Tumoren, wo man nur einen Schnitt machen muss, ist eigentlich auch so schon sehr sicher. Wo der Roboter sich dagegen gut eignet, ist Prostatakrebs. Im Grunde bei allen möglichen Operationen im Bauchraum; es kommt aber immer auf den einzelnen Patienten an. Man muss das individuell besprechen, zum Beispiel spielt es auch eine Rolle, ob der Bauchraum voroperiert ist.
Bei welchen Eingriffen ist der Roboter denn am ehesten geeignet?
Prof. Wirth: Der Roboter wird bei einer Vielzahl von Eingriffen im Bauchraum verwendet. Hier an der Klinik greifen neben der Urologie auch die Frauenklinik und die allgemeine Chirurgie auf den Roboter zu.
»Wenn es nicht um Ausbildung geht, operiert nur eine Person mit dem Roboter. Aber am Patienten direkt muss sich noch ein Arzt befinden.«
Ein Roboter-Sharing?
Prof. Wirth: Sozusagen. Die Urologie hat ihn an zwei Tagen in der Woche und die anderen Richtungen jeweils an einem Tag. Ich habe das damals so vorgeschlagen, weil das Gerät natürlich kostenintensiv ist. Aber die Technik war damals ganz neu, gesehen hatte ich das in den USA.
Wie hoch sind die Kosten für so ein Gerät ungefähr?
Prof. Wirth: In der Anschaffung hat der Roboter fast drei Millionen Euro gekostet. Das Gerät, das wir haben, besitzt zwei Konsolen, sodass zwei Mediziner gleichzeitig einen Bildschirm und die Instrumente nutzen können. So kann jemand trainiert werden, während ein erfahrenerer Operateur die Möglichkeit hat, einzugreifen, wenn etwas nicht optimal läuft. Wir können also junge Ärzte anlernen, ohne dass für den Patienten ein Problem entsteht, weil immer ein Erfahrener die Hände dabei hat.
Das ist wahrscheinlich nicht gerade die Standardausführung des Geräts?
Prof. Wirth: Nein, wir sind eine von wenigen Unikliniken in Deutschland, die das haben, und hatten es auch als erste Universitätsklinik. Das ist für die Ausbildung gut, und natürlich auch für die Patientensicherheit.
Gibt es noch andere Besonderheiten bei dem Roboter hier in Dresden?
Prof. Wirth: Mit unserem Gerät kann man intraoperativ verschiedene Dinge nachprüfen, das kann auch nicht jeder OP-Roboter. Zum Beispiel lässt sich über Fluoreszenz die Durchblutung messen. Außerdem kann man Lymphknoten nachweisen, dabei wird ein fluoreszierendes Medikament gespritzt, welches dann über die Lymphbahnen abtransportiert wird. So sieht man beispielsweise, welche Lymphknoten und -bahnen mit der Prostata verbunden sind. Natürlich geht das auch ohne Roboter, aber das Besondere ist, dass unser Gerät damit ausgerüstet ist. Man braucht dafür eine spezielle Technik mit speziellem Licht, das die Fluoreszenz erzeugen kann.
Wird das Gerät immer von zwei Personen bedient?
Prof. Wirth: Wenn es nicht um Ausbildung geht, operiert nur eine Person mit dem Roboter, aber am Patienten direkt muss sich noch ein Arzt befinden. Also wird er eigentlich immer zu zweit bedient. Und eine Schwester ist natürlich noch dabei. Aber der Operateur kann, wenn er erfahren ist, den Roboter allein bedienen. Manchmal sieht dann noch jemand zu, damit er etwas lernt. Auch da hat er wieder die Möglichkeit, alles dreidimensional zu erkennen.
Was macht der Arzt, der am Patienten steht?
Prof. Wirth: Der muss bei allen möglichen Dingen assistieren, zum Beispiel während der OP absaugen, damit der Operateur freie Sicht hat. Das ist seine Hauptaufgabe. Außerdem wechselt er, wenn nötig, die Instrumente.
Die Instrumente, die der Roboter führt, sind also auch austauschbar?
Prof. Wirth: Generell werden die für jeden Patienten ausgetauscht und sterilisiert. Es gibt da unterschiedliche, die man verwenden kann: Scheren, Messer, Elektromesser, Pinzetten, Halteinstrumente für das Gewebe oder solche, die beim Nähen helfen - natürlich sind die Instrumente auch sehr teuer. Das Problem dabei ist, dass diese Instrumente nur eine begrenze Haltbarkeit haben. Es ist also eine kostenintensive Angelegenheit: Pro OP brauchen wir Instrumente im Wert von 2.500 Euro und die Wartungskosten muss man natürlich auch noch bedenken.
Ist die Nutzung des Roboters in der OP generell sicherer?
Prof. Wirth: Wenn das Risiko höher ist, kann man ihn gut verwenden. Man muss aber auch bedenken, dass sich beispielsweise die Instrumente am Gerät viel langsamer wechseln lassen als bei einer offenen Operation, wo man nur danach zu greifen braucht. Bei komplizierten Dingen, wo es vielleicht auch schneller bluten kann, ist man also mit der Hand flexibler. Man kann aber auf jeden Fall nicht sagen, dass es möglich ist, nur noch den Roboter zu verwenden.
Also wird er nie alle Operationen übernehmen können?
Prof. Wirth: Mit dem aktuellen Stand nicht. Das liegt zum Beispiel daran, dass der Roboter keine haptischen Eigenschaften besitzt. Man kann also damit nicht fühlen, sondern sieht nur das Gewebe. Es wird aber auch daran geforscht, solche Fähigkeiten zu entwickeln.
Hat sich auf dem Gebiet schon etwas getan?
Prof. Wirth: Natürlich geht der Fortschritt ständig voran. Die hiesige Urologie war ja die erste, die so einen Roboter gekauft hat - ich glaube, das ist jetzt fast zehn Jahre her. Inzwischen haben wir schon seit zwei Jahren den zweiten, weil auch da die Entwicklung weitergeht. Im Vergleich zum Vorgänger hat sich schon einiges verbessert: Die Optik ist erheblich genauer, also die Auflösung der neuen Kamera - das ist ein Riesenvorteil. Außerdem ist der Gebrauch der Instrumente besser und einfacher geworden. Die Instrumente selbst sind auch länger, sodass man jetzt viele Dinge erreichen kann, die vorher zu weit weg lagen. Irgendwann wird man sicher auch die Instrumente noch leichter wechseln können und noch bessere Instrumente haben. Auch die haptische Entwicklung dauert sicher nicht mehr lange.
Wo werden diese Geräte entwickelt?
Prof. Wirth: Im Moment gibt es einen Monopolisten in den USA, was ein großes Problem ist, daher ist das auch alles so teuer.
Liegt das am Patent?
Prof. Wirth: Bisher lag das am Patent, aber inzwischen sind die Patente frei und es kommen jetzt auch deutsche Firmen, die versuchen, einen solchen Roboter zu entwickeln. Weltweit gibt es noch einige Firmen, die nun daran arbeiten, ein ähnliches Gerät zu bauen, das dann vielleicht sogar noch besser ist. Es wird auch Zeit, dass es da Konkurrenz gibt!
Wäre an der Klinik noch Bedarf für einen weiteren Roboter?
Prof. Wirth: Im Moment kommen wir mit einem sehr gut zurecht. Wenn sich die Indikationen erweitern würden, würden wir aber ein neues Gerät anschaffen. Vielleicht sind sie ja auch mit der Herstellerkonkurrenz irgendwann nicht mehr so teuer.
Prof. Dr. med. Dr. h.c. Manfred P. Wirth

Nach langjähriger Tätigkeit an der Universität Würzburg, kam Manfred Wirth 1992 als Professor für Urologie und Direktor der Klinik und Poliklinik für Urologie der Medizinischen Fakultät an die TU Dresden. Seit 2004 ist er im Vorstand der European Association of Urology (EAU) und war Mitglied im Beirat der Deutschen Krebshilfe e.V., außerdem fungiert er als Vorsitzender der Leitliniengruppe für Prostata-Krebs in Deutschland. Viele Jahre war er Vorstandsmitglied, 1. Vizepräsident und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Urologie e. V. Als Facharzt für Urologie (seit 1984) trägt er inzwischen die Zusatzbezeichnungen Spezielle Urologische Chirurgie (1997), Andrologie (2006) und Medikamentöse Tumortherapie (2007). Neben zahlreichen weiteren Auszeichnungen, ist er unter anderem Träger des Maximilian Nitze Preises, fungiert als Ehrenmitglied in mehr als 10 internationalen Urologischen Gesellschaften und eingeladener Referent auf einer Vielzahl nationaler und internationaler Tagungen. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Prostatakarzinom, Harnblasenkarzinom, Nierenzellkarzinom, Urologische Onkologie und rekonstruktive Operationen.