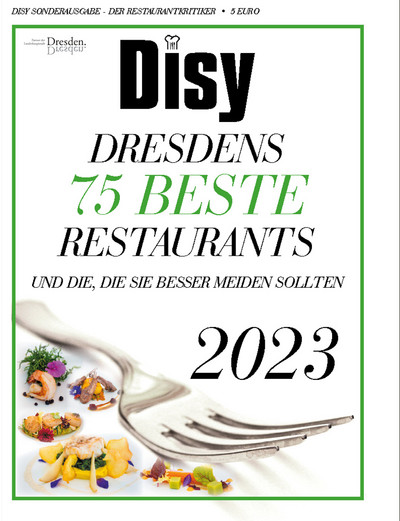- 4968 Aufrufe
Die Strahlentherapie wird immer effektiver

In Dresden wird jetzt ein Protonenbeschleuniger zur Krebsheilung eingesetzt, Disy hat mit dem für den Aufbau der Anlage verantwortlichen Projektleiter Stefan Pieck gesprochen
Diesen Herbst soll am Dresdner OncoRay Zentrum auf dem Medizinischen Campus des Universitätsklinikums ein Protonenbeschleuniger zur Krebsheilung in Betrieb gehen. Die Anlage ist deutschlandweit eine von dreien, welche Therapie und Forschung kombinieren. Die Nutzung von Protonenstrahlung könnte dabei zukünftig die Strahlentherapie revolutionieren, aber im Moment ist der Aufwand noch sehr hoch.
Was macht den Protonenbeschleuniger in Dresden einzigartig?
Stefan Pieck: Weltweit einmalig bei unserer Anlage ist, dass wir einen großen Experimentalbunker innerhalb eines klinischen Forschungsbereichs haben. Dort kommen die Patienten nicht rein, der Raum ist nur für physikalische und biologische Versuche vorgesehen. Außerdem arbeiten wir mit den Kollegen des Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) und ultraoptics in Jena an einem alternativen Beschleunigungskonzept für diese Teilchen, also zum Beispiel Protonen oder Schwerionen. Dafür werden Hochintensitätslaser genutzt. Die Gründe setzen sich folgendermaßen zusammen: Schon bei Protonen muss sehr viel Schutz vor der entstehenden Strahlung angebracht werden - wir haben hier Wanddicken von bis zu sechs Metern! Arbeitet man mit Schwerionen muss noch viel mehr Strahlenschutz vorhanden sein, folglich wird die Anlage noch größer und noch teurer. Der Beschleuniger hat dann beispielsweise keinen Durchmesser mehr von fünf bis sechs Metern, sondern eben von 20 Metern.
Ein alternatives Konzept soll den Aufwand minimieren?
Stefan Pieck: Das Beschleunigungskonzept, das wir erforschen, basiert auf dem Einsatz von relativ kompakten, also vielleicht garagengroßen Hochleistungslasern. Das sehr energiereiche Licht des Lasers trifft dann auf so etwas wie eine Folie, wo die Protonen emittieren. Der Ringbeschleuniger, also das Zyklotron, wäre dann nicht mehr notwendig, außerdem braucht man für Laser keinen Strahlenschutz, sondern nur optische Schutzbrillen, sodass der gesamte Aufbau günstiger wird und weltweit mehr Anlagen entstehen könnten.
Was ist im Moment noch das Problem dabei?
Stefan Pieck: Nur die Teilchen zu erzeugen reicht nicht aus. Die Leistung der Laser muss in den so genanten Petawattbereich kommen, damit die Teilchen auch die notwendige Energie für die Therapie haben. Diese Energie bestimmt die mögliche Eindringtiefe in den Körper, daher brauchen wir einiges an Power, und das ist eine ziemliche Herausforderung für die Forschung und wird noch fünf bis zehn Jahre dauern. Das ist in Zusammenarbeit mit dem HZDR hier in Dresden eines unserer Forschungsprojekte.
Warum haben Sie sich überhaupt für die aufwendige Protonenanlage entschieden?
Stefan Pieck: Die Linearbeschleuniger, die wir bisher in Dresden und deutschlandweit für die Therapie nutzen, arbeiten mit Strahlung aus Elektronen und Photonen. Dabei entsteht ultraharte Röntgenstahlung. Die Anlage, die das kann, ist jetzt schon relativ kompakt, das Handling ist preisgünstiger, aber die Dosiskurve bei diesen Teilchen ist nicht so günstig, weil die Strahlung, die an das gesunde Gewebe abgegeben wird, höher ist. Die Nutzung von Protonen hat den Vorteil, dass sich in der Tiefe ganz genau steuern lässt, wo die Energie abgegeben wird. Hinter dem Zielort ist dann so gut wie gar keine Strahlung mehr vorhanden. Man kann mit der Strahlentherapie heute schon sehr viel machen, aber um noch besser zu werden, wollen wir Protonen einsetzen. Auch wenn der Preisunterschied im Moment noch immens ist. So ein Linearbeschleuniger kostet in der Anschaffung zwei bis drei Millionen Euro, mit der Protonentherapieanlage mit Gebäude liegt man im hohen zweistelligen Millionenbereich - dazu kommt dann noch die Wartung. Entsprechend teurer ist sicher auch die Therapie.
Welche Patienten bekommen denn eine Bestrahlung mit Protonen und welche nicht?
Stefan Pieck: Nicht alle Krebspatienten werden von einer Protonentherapie profitieren. Befindet sich beispielsweise hinter dem Tumor ein Risikoorgan, könnte das eine klare Indikation für die Protonenbestrahlung sein. Die Krankenkassen haben eine gewisse Indikationsliste, zum Beispiel werden Hirntumore akzeptiert, Kinder, die erkrankt sind, und eine Reihe anderer Tumore, bei denen die Kosten erstattet werden. Bei der Behandlung wird von Anfang an ein Photonenplan und ein Protonenplan erstellt, sodass sichtbar wird, welcher Patient eindeutig von der Therapie profitiert. Die neue Therapie bringt also vor allem in speziellen schwierigen Fällen etwas. In klinischen Studien wollen wir zeigen, wo Protonen gegenüber Photonen einen Vorteil haben. Also versuchen wir dann auch so viele Patienten wie möglich in klinische Studien zu integrieren.
Am OncoRay Zentrum betreiben Sie Strahlenforschung für die Krebstherapie, das heißt, bei Ihnen kommen keine OP-Techniken zum Einsatz, oder?
Stefan Pieck: Die Onkologie wird mit drei Hauptsäulen betrieben: Chirurgie, internistische Therapie - im Volksmund Chemotherapie - und Strahlentherapie. Letztere ist inzwischen an 60 Prozent der Krebsheilungen beteiligt. Bei uns am Institut steht deshalb die medizinische Strahlenforschung in der Onkologie im Mittelpunkt. Unsere Fragestellung lautet also: Wie kann man die Strahlentherapie verbessern, zum Beispiel durch biologisch individualisierte Therapie, durch technologische Optimierung und so weiter. Das heißt, hier arbeiten Biologen, Physiker und Mediziner interdisziplinär zusammen, um sich diesem Thema von verschiedenen Richtungen zu nähern.
»Translationale Forschung ist ein sehr wichtiger Begriff für uns.«
Wie hat sich das in Dresden entwickelt?
Stefan Pieck: Das Forschungszentrum ist jetzt rund zehn Jahre alt und wird gemeinsam getragen von der Medizinischen Fakultät der TU Dresden, dem Universitätsklinikum und dem Helmholtz Zentrum Dresden-Rossendorf. Die Gründung fand durch ein BMBF-Programm statt, im Rahmen der Zentren für Innovationskompetenz (ZIK), OncoRay ist also ein ZIK, genau wie zum Beispiel das BCUBE, das auch aus diesem Programm gefördert wird. Bis vor einem Jahr saßen wir nebenan im Haus 31, dort wird jetzt gerade gebaut. Jetzt kann man sich die Frage stellen, warum wir jetzt hierher kommen. Entstanden ist OncoRay aus der Strahlentherapie, die Gebäude gehören auch zu einem Komplex. Unser Institut bildet damit einen Teil der Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie, die die Initiative OncoRay ins Leben gerufen hat. Zuerst hatten wir daher aus Platzgründen auch dort unsere Büroräume und Labore.
Aber jetzt sind Sie umgezogen...
Stefan Pieck: Schon im Jahr 2008 haben wir im Rahmen der Landesexzellenzinitiative des Freistaates Sachsen erfolgreich umfangreiche Mittel für ein neues Gebäude eingeworben, das waren circa dreißig Millionen Euro. Zwei Jahre lang haben wir unsere eigenen Räume geplant und gebaut. Wir beginnen unsere Forschungsarbeiten in der Zellkultur unter der Sterilbank, gehen dann in ein 3D-Zellmodell, bei vielversprechenden Ergebnissen nutzen wir anschließend ein Tiermodell und machen dann klinische Studien. Translation ist ist ein sehr wichtiger Begriff für uns; dabei liegt der Schwerpunkt immer auf der Verbesserung der Strahlentherapie. Das ist unser starker Fokus. Man könnte sagen, OncoRay ist so etwas wie die Forschungsabteilung der Strahlentherapie.
Warum braucht man dafür so viel Platz?
Stefan Pieck: Den Hauptteil des Gebäudes bestimmt die Protonentherapieanlage, das ist die größte Maschine hier. Erzeugt werden die Protonen im so genannten Zyklotron, das ist ein Ringbeschleuniger mit einem Durchmesser von fünf Metern und einem Gewicht von 220 Tonnen.
Wie werden die Protonen dort erzeugt?
Stefan Pieck: Streng genommen werden keine Protonen erzeugt, sondern nur aus einem neutralen Atom "herausgeholt". Wenn man einen Wasserstoffkernatom nimmt und das NeutronElektron entfernt, hat man anschließend nur noch das Proton. Wir spritzen daher Wasserstoffgas ein und ionisieren es, indem wir es mit anderen Elektronen beschießen, wodurch das Proton vom NeutronElektron des Wasserstoffatoms getrennt werden weg, das bedeutet, wir nehmen es zum Beispiel mit einem Lichtbogen weg. Das übrig gebliebene Proton wird anschließend auf einer Kreisbahn spiralförmig beschleunigt, bis es drei Viertel der Lichtgeschwindigkeit erreicht, dann verlässt es das Zyklotron und geht in die so genannte Beamline.
Was passiert dort?
Stefan Pieck: Das Proton ist ja ein elektrisch geladenes Teilchen, dadurch lässt es sich mit Magneten in der Richtung lenken und fokussieren. Die Beamline ist ein Edelstahlrohr, in dem ein Hochvakuum anliegt, damit die Teilchen nicht gebremst oder gestreut werden. Mithilfe von Magnetpaketen transportieren wir so die Protonen über die rund 40 Meter, die zwischen dem Erzeugungs- Beschleunigungsort im Zyklotron und dem Patienten liegen.
Warum muss dazwischen so viel Platz überbrückt werden?
Stefan Pieck: Bei diesen Größenordnungen geht das nicht anders. Das Zyklotron muss in einem Strahlenschutzbunker stehen, damit auch der Patient nicht gefährdet wird, wenn so viel Strahlung entsteht. Der befindet sich dann zur Behandlung in der so genannten Gantry.
Was ist das genau und was passiert dort?
Stefan Pieck: Bei der Strahlentherapie haben wir generell ein Problem: Man kann den Tumor zwar bestrahlen, aber die Dosis ist limitiert, weil immer auch das umliegende Gewebe ein wenig Strahlung abbekommt. Daher nutzt man eine Mehrfeldertechnik, also man sendet einen Strahl ab, dann verändert man den Winkel und strahlt in eine andere Richtung auf den Tumor. Auf diese Art ist heute schon standardmäßig eine Bestrahlung aus 360 Grad möglich. Um das auch bei den Protonen anzuwenden, benötigen wir die Gantry, denn der Strahl kommt horizontal in der Beamline an und muss dann zum Patienten gelenkt werden, und das aus verschiedenen Richtungen. Man könnte dafür natürlich den Behandlungstisch bewegen und beispielsweise ankippen, aber dann würde sich die Lage der Organe immer verändern. Deswegen wurde die Gantry entwickelt.
Und wie sieht dieses Gerät aus?
Stefan Pieck: Die Gantry ist ein Stahlkoloss von 110 Tonnen und einem Durchmesser von elf Metern; sie sieht in etwa aus wie ein großes MRT. In dieser Konstruktion liegen Umlenkmagneten, welche den Winkel der Strahlung quasi unbegrenzt verändern können. An der so genannten Nozzle tritt der Strahl dann aus und kann von allen Seiten auf den Patienten treffen, je nachdem, wie die Therapie geplant ist und in welchem Bereich der Tumor liegt.
Wievel Strahlung wird dann abgegeben?
Stefan Pieck: Es wird eine festgelegte Dosis abgestrahlt, die aber nicht mit einem Mal gegeben wird. Die Strahlentherapie läuft fraktioniert, also bekommt der Patient über sechs Wochen jeden Werktag einen Teil der Dosis.
Also können Sie auch nur begrenzt Patienten gleichzeitig behandeln. Wie hoch ist die Auslastung?
Stefan Pieck: In der Strahlentherapie mit den sozusagen konventionellen Linearbeschleunigern liegen wir bei über 2.200 Patienten pro Jahr. Mit den Protonen sind ungefähr 430 pro Jahr möglich.
Wie lange dauert so eine Bestrahlung dann jedes Mal?
Stefan Pieck: Die eigentliche Dosis wird in rund zwei Minuten abgestrahlt. Aber den Patienten ganz genau wieder in die Position zu bringen, kostet zusätzliche Zeit. Hier geht es ja um Hochpräzisionsbestrahlung, da kommt es genau auf den Millimeter an. Es gibt dafür dann zum Beispiel Anzeichnungen auf dem Körper, damit der Patient wieder genauso liegt wie beim letzten Mal. Er wird dann mit Hilfe von Lasern in die Richtige Position gefahren und bekommt dann je nachdem, wo der Tumor ist, zum Beispiel eine Kopfmaske oder ein Vakuumkissen, damit er wieder ganz genauso liegt. Das kostet eben Zeit, insgesamt vielleicht zehn Minuten, aber bei den Protonen ist alles noch etwas genauer und schwieriger, da rechnen wir pro Patient circa eine halbe Stunde Vorbereitung ein.
Können die Organe auch einmal anders liegen?
Stefan Pieck: Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Beispielsweise bei einem Hirntumor sind die Verhältnisse einfach, in der knöchernen Kapsel gibt es fast keinen Spielraum, da liegt alles gleich und lässt sich gut fixieren. Liegt der Tumor aber im Abdomen, kann er sich natürlich sehr leicht verschieben. Bei bewegten Körperteilen oder Organen, wie zum Beispiel bei der Lunge mit ihren Atembewegungen, gibt es das Positionsproblem sogar schon in der Bestrahlung. Ein Teil der heutigen Forschung und Entwicklung widmet sich daher dem so genannten Gating; dort versucht man, den Tumor nur dann zu bestrahlen, wenn er genau im Bestrahlungsfenster liegt, ansonsten setzt die Bestrahlung aus.
Wie kann der Beschleuniger das erkennen?
Stefan Pieck: Das ist etwas schwierig. Man muss entweder einen Gurt am Patienten befestigen oder externe Marker auf die Haut setzen und dann über Kameras filmen, sodass der Beschleuniger erkennt, wo der Tumor eigentlich gerade ist. Unabhängig davon, welche Strahlenart man einsetzt, hat man da dieselben Probleme.
Wie wurde die Anlage auf ihren Betrieb vorbereitet?
Stefan Pieck: Nach Abschluss der Kommissionierungsphase, das bedeutet, dass unsere Medizinphysiker genau nachgemessen haben, ob die Anlage das leistet, was wir mit einem Bestrahlungsplan einbringen, ging sie in Betrieb. Dabei haben wir so getan, als hätten wir einen Patienten in der Gantry und nutzten, um das Gewebe zu imitieren, ein Wasserphantom, also eigentlich ein Aquarium, weil das der Substanz sehr nahe kommt. Bei der Bestrahlung wird mit Apparaturen im Wasserphantom gemessen, ob auch die Dosis ankommt, die wir am Anfang rein gegeben haben.
Ist die Kommissionierung einfach eine Kontrolle, die die Tests bestätigen soll, die in ihrem Experimentalbunker schon am Modell gemacht wurden?
Stefan Pieck: Die Anlage, die wir nutzen, ist sehr komplex und erstreckt sich über viele Meter. Es gibt viele Parameter, die Auswirkungen haben, und alle Teile müssen aufeinander abgestimmt werden, damit es für den Patienten sicher ist. Das ist nicht zu vergleichen mit einem kompakten Gerät, das man kaufen und aufstellen kann. Und selbst unsere relativ kompakten Linearbeschleuniger, die wir bisher nutzen, müssen vor der medizinischen Anwendung diese Kommissionierung durchlaufen. Natürlich ging das dort wesentlich schneller.
Wie lang dauerte diese Phase mit dem Protonenbeschleuniger?
Stefan Pieck: Unsere Kommissionierungsphase lief jetzt seit April diesen Jahres.
Gibt es in Deutschland schon vergleichbare Anlagen, die in Betrieb sind?
Stefan Pieck: In Essen gibt es eine, die sehr ähnlich ist. In Heidelberg befindet sich eine Anlage, die mit Schwerionen arbeitet, also noch schwerere Teilchen nutzt als Protonen. Dafür nimmt man Kohlenstoffkerne, die schwerer sind. Das Prinzip ist vergleichbar, nur die Dosisverteilung ist etwas anders. Außerdem gibt es eine privat betriebene Klinik in München, wo Protonentherapie angeboten wird. Bundesweit sind wir mit Dresden also der vierte beziehungsweise dritte Standort, weil die Anlage mit Forschung und akademischen Einrichtungen verbunden ist. Für Ostdeutschland ist die Dresdner Anlage die erste ihrer Art.
Woran forschen Sie hier in Dresden noch?
Stefan Pieck: Wir beschäftigen uns außerdem mit InVivo-Dosimetrie, das bedeutet, wir messen anhand von Sekundäreffekten, die die Teilchen im Körper erzeugen, welche Dosis im gesunden Gewebe und überhaupt im Patienten angekommen ist. Diese Effekte zeigen sich in Form von so genannten Prompt-Gamma- Teilchen, die man messen kann. Man sieht dabei auch den Unterschied der Protonennutzung im Vergleich zu anderen Teilchen.
Stefan Pieck

Stefan Pieck studierte in Kiel an der Christian -Albrechts-Universität von 1991 bis 1998 Biologie und kam anschließend als wissenschaftlicher Mitarbeiter an die TU Dresden. Am ZIK OncoRay arbeitet er als Wissenschaftlicher Koordinator und OncoRay-Projektleiter am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus.