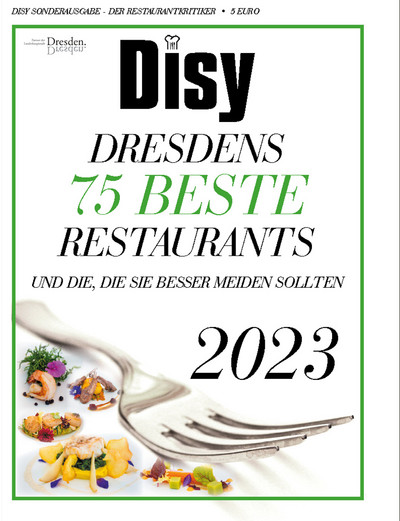- 4025 Aufrufe
Die nächste Generation

Warum vernachlässigen die aktuellen Auswahlkriterien für junge Ärzte den menschlichen Faktor? Warum entscheiden sich immer mehr Abiturienten zwar für die Ausbildung zum Arzt, aber gegen den Beruf? Und was kann die junge Generation von deralten lernen, wenn sich alle fünf Jahre der medizinische Kanon ändert? Wir sprachen mit Prof. Dr. Michael Albrecht, Medizinischer Vorstand des Uniklinikums.
Was würden Sie an den Ausbildungsstandards verändern, wenn Sie könnten?
Albrecht: Ich glaube, dass wir in Deutschland seit vielen Jahrzehnten eine hervorragende, theoretische Arztausbildung machen. Das Problem ist, dass in der Medizin alles nach fünf Jahren veraltet ist. Wenn man dann nur auf den Inhalt achtet, wird es langfristig nicht funktionieren. Noch wichtiger ist, dass die zwischenmenschliche Arbeit nicht zu kurz kommt. Wie vermittelt man den Patienten sein Wissen, ohne ins Fachchinesisch abzugleiten? Wie überzeugt man Patienten, dass sie einem mithelfen, sich selbst zu heilen? Das Problem fängt schon bei der Auswahl der Auszubildenden an. Wir suchen stur die Falschen aus. Jeder Steuerzahler beteiligt sich an den Ausbildungskosten von 250.000 Euro im Jahr für einen Arzt. Für diese Menge Geld kann man verlangen, dass wir die Richtigen auswählen. Doch dass wir in Deutschland stur die Abiturnote als Kriterium für die Zulassung nehmen, halte ich für falsch.
Wie würden Sie auswählen?
Albrecht: Natürlich sind die schulischen Leistungen wichtig. Die geben einem schon ein Gefühl für Fleiß und Lernbereitschaft. Ich würde aber mehr darauf achten, wie die Persönlichkeit des Anwärters ist. Was will der, wieso hat er oder sie sich dafür entschieden, Arzt zu werden? Denn die Geschichte mit der Abiturnote führt dazu, dass man zum Beispiel eine 1,2 im Abi haben muss, um Medizin studieren zu können. Ich wäre dann kein Arzt geworden. Schauen Sie sich die an, die heute mit 1,0-Abis aus der Schule gehen. Die waren zu meiner Zeit nicht unbedingt meine Freunde. Das führt auch dazu, dass wegen der Schulnote 70 Prozent der Studenten Frauen sind. Die Motivation bei Frauen ist aber häufig eine andere. Ich frage meine Studentinnen im ersten Semester immer, was ihre Motivation ist. Jede zweite antwortet, was sie mit ihrer Abi-Note sonst machen sollten. Das macht mich wahnsinnig! Wenn von 250 Anfängern 70 Prozent Frauen sind, dann stimmt auch die Verteilung nicht mehr. Da könnte man auch über eine Quote reden. Ein weiteres Problem ist, dass die ZVS (Zentrale Verwaltungsstelle) die Studienplätze vergibt. Ich wünsche mir ein Verfahren, in dem die Abiturnote maximal zwei Drittel Gewicht hat. Man müsste weiterhin eine Bewerbung schreiben, einen Eingangstest machen und die Leute zu einem persönlichen Gespräch laden. Wir machen zwar bei inzwischen über der Hälfte unserer Bewerber Auswahlgespräche, allerdings kommt die Zulassung dafür auch über die Abiturnote.
Wann wird ein Bewerber zum Gespräch geladen?
Albrecht: Sie müssen bei der Bewerbung an die ZVS ankreuzen, ob Sie an einem Auswahlgespräch teilnehmen wollen. Dann wird eine Quote verteilt, je nach Standort, von einem Drittel. Das heißt, dass je nach Anzahl an Bewerbern ein Schnitt gemacht wird. Die anderen Plätze sind für die Auswahlgespräche. Da werden doppelt so Anwärter viele zu Gesprächen geladen, wie wir dafür Ausbildungsplätze haben.
Könnten Sie in Ihrer Position etwas am Zulassungskriterium ändern?
Albrecht: Das ist zwischen Bund und Ländern festgelegt. Der Freistaat müsste aus der allgemeinen Studienplatzvergabe aussteigen. Ich fände es gut, wenn wir die Bewerbungen direkt bekommen würden. Letztes Jahr haben sich in ganz Deutschland über 95.000 Abiturienten auf ein Medizinstudium beworben. Bei gerade mal 10.000 Plätzen. Da kann man sich vorstellen, was das für Konsequenzen hat. Aber man bewirbt sich nicht am Standort und das Profil des Standortes ist bei der Bewerbung nicht ausschlaggebend.
Das heißt, wenn sich die Leute direkt hier bewerben würden, wäre das zwar mehr Aufwand für die Uni, aber Sie hätten am Ende kompetentere Mediziner?
Albrecht: Das ergäbe zwei Probleme. Wenn ich die Leute danach aussuche, von denen ich glaube, dass sie die besten Ärzte werden, dann sind das die, die nach fünfzehn Jahren noch mal in ein Buch schauen, die teamfähig und kommunikativ sind. Haben die jedoch beim Abitur eine eher schlechte Note erreicht, werden sie auch in ihrer Abschlussarbeit keine Bestnoten haben. Das wiederum führt dazu, dass die Universität im Ranking zurück fällt. AmEnde wird man als Uni für die Abschlussnoten bezahlt und nicht für das Ausbilden guter Ärzte.
Die Zeiträume, in denen man abschließend beurteilen kann, ob eine Universität einen erfolgreichen Arzt ausgebildet hat, sind sehr groß. Man kann seine Studenten ja nicht nach 30 Jahren erneut kontrollieren.
Albrecht: An der McMaster-Uni hat man das versucht. Die haben über einen Zeitraum von zehn bis 15 Jahre den Werdegang ihrer Abgänger verfolgt. Eins ist klar, wenn wir alle gemeinsam Geld dafür ausgeben, dann sollten wir auch die ausbilden, die dahinter stehen. Wenn dann 20 bis 30 Prozent sagen, sie wollen gar nicht als Arzt tätig sein, sondern lieber Medizinjournalist werden, dann ist es schade um das Geld. Ich würde eher einen zulassen, der sagt, dass er in die Entwicklungshilfe geht oder der sich für einen Arztjob auf dem Land entscheidet. Einfach nur, weil es ihm Spaß macht, mit Menschen zu arbeiten.
Das Alter spielt bestimmt auch eine Rolle, oder? Mit 18 hat man eine ganz andere Einstellung als mit 25.
Albrecht: Das stimmt, aber man braucht auch eine gewisse Grundeinstellung. Wenn ein Anwärter von vornherein sagt, dass er in München oder am Starnberger See arbeiten will und wenn möglich ohne Nachtschicht und mit pünktlichem Feierabend und alte Menschen generell nicht leiden kann, dann ist er für die Tätigkeit weniger geeignet.