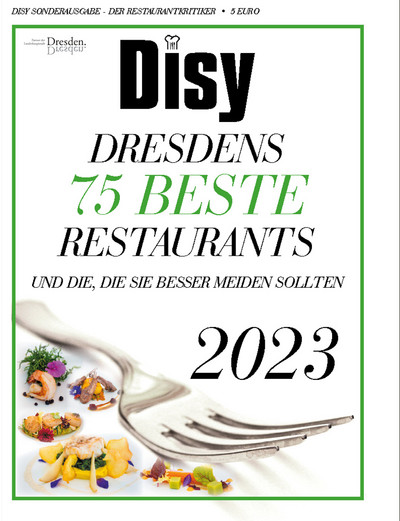- 4599 Aufrufe
Ein Dresdner auf der Spur nach versunkenen Schätzen

In 50 Meter tiefe kommt nur wenig Sonnenlicht an. Der aufgewirbelte Meeresboden verringert die bereits schlechte Sicht zusätzlich. Selbst mit starker Lampe sieht das menschliche Auge nur einen guten Meter weit. Vorsichtig taucht Martin Wenzel um ein 200 Jahre altes Wrack.
Mit bloßen Händen schiebt er den Sand zur Seite – und wirbelt noch mehr auf. Dann beschleunigt sein Puls. An der Oberfläche des Meeresboden erscheint ein Porzellandeckel, erst der Griff, dann die ganze Platte. Wenzel legt sie vorsichtig in einen Plastikkorb und gibt das Signal. Der Korb wird nach oben gezogen. Er jedoch muss noch zwei Stunden im Wasser bleiben, bis er dekomprimiert genug ist um aufs Schiff zurückzukehren und sein Fundstück, seinen Schatz zu begutachten.
Martin Wenzel ist Schatztaucher und President Commissioner von Nautik Recovery Asia. Zu den Team-Leadern gehören außerdem CEO Klaus Keppler, Chef-Taucher Jean Paul Blancan und Chef-Archeologe Fred Dobberphul. Wenzel, der eigentlich eine Immobilienfirma leitet, taucht mit ihnen seit vielen Jahren nach versunkenen Schiffen. Hier, vor der Küste Jakartas, sind unzählige im Meer. Indonesien liegt auf der früher wichtigen Handelsroute zwischen China und Philippinen. „Und die Gewässer waren gefährlich. Viele Riffe und kleine Inseln machten den Seefahrern das Leben schwer“, erzählt Wenzel. Wie viele Schiffe genau untergegangen sind, das weiß niemand. Die UNESCO geht davon aus, dass über 3.000.000 Wracks weltweit auf dem Meeresboden liegen. Allein die Dutch East India Company verlor zwischen 1602 und 1800 1.300 Schiffe. Sie alle waren beladen mit Gold, Silber, Schmuck, Jade und Porzellan, das heute Millionen von Euros wert ist. Bei der letzten Expedition barg Nautik Recovery Asia die 1806 gesunkene Forbes. In ihrem Bauch fand man neben 16 Kanonen, diverses Porzellan und Keramik auch achteinhalb Tonnen Silbermünzen – rund 33.000 Stück. Jede einzelne mit einem Wert von 200 Euro. „Insgesamt war der Schatz 10 Millionen Euro wert“, erzählt Wenzel.
Während er erzählt, sitzt er an seinem großen Schreibtisch in einer Villa in Dresden unweit der Waldschlösschenbrücke. In seinem Büro steht ein Billardtisch, darauf liegt eine Flugdrohne. Immer wieder zeigt er auf zwei großen Flachbildschirmen Bilder und erklärt: „Hier sieht man unser altes Schiff. Es ging leider unter. Und das hier sind die geborgenen Kanonen“. Mit ruhiger Stimme er- zählt er von den Expeditionen, als wäre es ein gewöhnliches Hobby. Drei bis vier Mal im Jahr fliege er runter.
Ich wollte das schon als Kind machen, auf Schatzsuche gehen“, erzählt er. Es sei zwar sehr anstrengend und kostenintensiv, doch das ist ihm egal. „Wenn wir eine Woche lang auf See sind und nichts bergen können, dabei aber jeden Tag 3.000 Euro ausgeben, das kann schon frustrieren“, so Wenzel. „Aber wenn ich unter Wasser bin und etwas finde, dann ist alle Anstrengung vergessen.“
Bevor er und sein 50-köpfiges Team überhaupt in den Gewässern nach den Wracks suchen, braucht es viel Vorbereitungsarbeit. Um herauszufinden, wo die gesunkenen Schiffe sind, gibt es drei Möglichkeiten. Die erste, aufwendigste und uneffektivste ist es, auf gut Glück mit einem Sonargerät nach Auffälligkeiten auf dem Meeresboden zu schauen. Effektiver ist es, in Archiven und Bibliotheken nach Hinweisen zu gucken. „Wir arbeiten häufig mit Fischern vor Ort zusammen. Sie haben ein Netzwerk, kennen die Gewässer sehr genau und geben uns hilfreiche Tipps“, sagt Wenzel. Hat man eine ungefähre Idee, wo sich eines der Wracks befinden könnte, muss eine Erlaubnis bei der indonesischen Regierung eingeholt werden. Denn die Wracks gehören faktisch dem Staat, weil sie in ihren Gewässern liegen. Jedoch fehlt es Indonesien an Know-How, Technik und den finanziellen Mitteln, eigene Expeditionen zu starten. „Was das Meer ein- mal hat, gibt es nur ungern wieder her“, so Wenzel. Ist die Erlaubnis erteilt, und die Bürokratie ist nur mit Einheimischen zu bewerkstelligen, geht es zusammen mit Regierungsvertretern und dem Militär aufs Meer. „Es gibt Piraten und vor denen müssen auch wir beschützt werden“, erzählt Wenzel. Wird ein Schatz gefunden, aus denen sich Profit generieren lässt, wird der Gewinn zwischen der Regierung und dem Bergungsunternehmen geteilt. Dennoch lohnt sich die Schatzsuche auch finanziell. Bei früheren Expeditionen betrug die Rendite für Investoren zwischen 210 und 450 Prozent.
Martin Wenzel steckt inzwischen in den Vorbereitungen für das nächste Wrack. Er ist auf der Suche nach einem französischen Schiff, dessen Kapitän von einer Sklavin vergiftet wurde. Man darf gespannt sein, was Nautik Recovery dort findet.