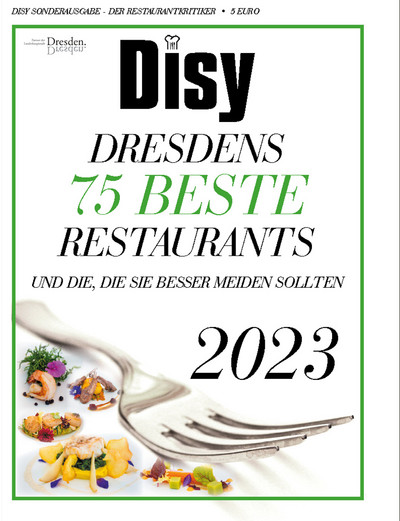- 5025 Aufrufe
Einmal um die Welt, bitte! - Teil 3

Zwei Monate war Anja K. Fließbach schon mit ihrer Tochter auf dem Schiff unterwegs, als sie Tahiti erreichte. Lesen Sie heute im 3. Teil ihres Weltreisereports über die Inseln der Südsee, ihr Treffen mit dem Prime Minister von Samoa, die ersten Erlebnisse in Japan und wie sie die Zeit austrickste.
Gottesdienst in PAPEETE
Leise und warm wehte der Wind durch die Kirche. Es war, als streichelte er mich, tröstete mich, und trotzdem hinterließ er eine leichte Gänsehaut auf meinen Armen. In der Luft lag der süße Geruch von Hibiskusblüten. Die Sonne schien gedämpft durch die bunten Fensterbilder. Doch das Göttlichste in diesem Augenblick war der Gesang der Gläubigen. Es war mit Abstand das Schönste, was ich jemals gehört hatte. Es war ein Gesang voller Liebe und Trauer, mehrstimmig, schön, hell, klar. Es sang kein Chor, sondern es waren die einfachen Menschen, die an diesem Sonntag in die kleine Kirche in Papeete auf Tahiti gekommen waren. Die Polynesier sind bekannt für ihre harmonischen Melodien und Gesänge, die die Sanftheit und Süße ihrer schönen Inseln ausdrücken. Aber was ich hier in dieser Kirche hörte, überstieg jegliche Vorstellungskraft.

Es war der Gesang von Menschen, die das Fühlen nicht verlernt hatten. Mit unglaublicher Kraft und Leidenschaft legten sie ihr Herz und ihre Seele in diese Lieder. Wie im Trance hatte uns der Gesang angezogen, als wir durch die Stadt gelaufen waren. Wir konnten nicht anders, als in der Mitte der Polynesier Platz zu nehmen und für zwei Stunden mit ihnen eins zu werden. Die ganze Kirche war erfüllt von Liebe und einem Gefühl der Gemeinschaft. Die Frau neben mir, die mit ihrem Hut und dem langen Kleid einer Südstaatlerin ähnelte, berührte mich leicht an der Schulter und lächelte, als sie meine Tränen sah. Eine Mutter mit drei Kindern auf der anderen Seite nickte uns freundlich zu. Der Pfarrer schloss uns in seinen Segen mit ein. Wir gehörten in dem Moment so selbstverständlich in diese Gemeinschaft, dass es mich trotz der heißen Temperaturen fröstelte. Louisa und ich waren die einzigen Auswärtigen. Als der letzte Ton verklungen war und der Gottesdienst offensichtlich zu Ende, kehrte Stille ein. Es war wie dieser kurze Augenblick im Theater nach einer beeindruckenden Vorstellung, wenn die Leute kurz zu sich kommen müssen, bevor der Applaus losbricht. Hier in dieser freundlichen Kirche auf Tahiti wollten die Menschen offenbar nicht zu sich kommen. Es vergingen zehn Minuten, zwanzig, eine halbe Stunde. Louisa und ich saßen still mittendrin und auch wir konnten nicht aufstehen. Ich wollte nicht weg von diesem Ort. Ich wollte den Augenblick anhalten. In diesem Moment war ich glücklich und zufrieden. Es gab nichts und niemanden in diesen Minuten, den ich vermisste. Es gab keinen Ort auf der Welt, wo ich in diesem Moment sonst hätte sein wollen. Es war alles genau richtig. Unsere „MS Amadea“ lag drei Tage im Hafen von Papeete. Tahiti war nicht die schönste Südseeinsel, hatte aber ihren eigenen Charme.
TAHITI -ITI
Louisa und ich erkundeten die Insel zu zweit. Tahiti ist mit 1000 qkm und über 130.000 Einwohnern die größte Insel in Französisch-Polynesien. Schon 1768 war der französische Forscher Louis Antoine de Bougainville hier gelandet. Als wir durch Tahitis Hauptstadt Papeete streiften, genossen wir die Hektik und den Trubel nach all den beschaulichen und ruhigen Inselchen, die wir in den letzten Tagen besucht hatten. Wir kauften Geschenke und neue Kleider für Louisa. Nach der Weltreise würde sich Oma Ina zu Hause wundern, wir groß ihre Enkelin in fast fünf Monaten geworden war. Mit der Oma telefonierten wir eine Weile aus einer warmen Telefonzelle, bevor wir uns einen Lunch im überfüllten Mc Donalds gönnten. Nach der Natur pur empfanden wir die Burger und Pommes als Luxus - immer das, was man gerade weniger hat. Etwas ruhiger wurde es außerhalb der Stadt. Der Dschungel im Inneren der Insel ist so urwüchsig, dass man nur schwer hinein kommt. Der erloschene Vulkan Ohorena überragt mit seinen 2200 m die Landschaft. Die zwei Inseln, aus denen Tahiti besteht, Tahiti-Nui und Tahiti - Iti, sind durch eine Landenge verbunden. Besonders schön ist eine Fahrt um die Insel Tahiti Nui - 120 km holperige Straße, und man ist drum herum. Wir hatten Zeit genug, das Grab von König Pomare V. zu besichtigen, dem letzten König Tahitis. Die Urne auf seinem Grab wird von den Einheimischen als Schnapsfl asche bezeichnet. Der König starb an Trunksucht. Viele Sehenswürdigkeiten gibt es sonst nicht. Erwähnenswert ist noch das Arahoho Blowholes, Wasserfontainen, die mit großem Druck aus dem Gestein schießen. Nett sind auch die Maraa Grotto - kleine Grotten mit Wasserfällen zum Baden.

Die Urne auf seinem Grab wird von den Einheimischen als Schnapsflasche bezeichnet. Der König starb an Trunksucht. Sehr schade war, dass wir das Musée Gauguin nicht besichtigen konnten, weil es am Wochenende geschlossen ist. Paul Gauguin kam 1891 nach Tahiti und malte in dieser Gegend 60 Bilder. Oft stand seine polynesische Frau Teha´amana dafür Modell. Doch hier auf Tahiti existieren keine Originale mehr, nur Reproduktionen. Gauguin starb mit 55 Jahren an Syphilis auf Hiva Oa (gehört zu den Marquesas), wohin er übergesiedelt war. Eigentlich wollten wir auch noch ein paar von den typischen schwarzen Perlen kaufen, die es im Tahiti Perles Centre gab und wo man sehen konnte, wie die berühmten Perlen gezüchtet wurden. Aber auch drei Tage gehen schnell vorbei. Vielleicht auf einer anderen Insel.

Wie man einen TAG ÜBERSPRINGT
Eigentlich hat Korbinian Arendt am 18. Februar Geburtstag. Auf der Weltreise fiel sein Ehrentag für ihn aus. Weil die „MS Amadea“ schneller war als die Zeit. Im Ernst: Bei unserer Reise um die Welt hatten wir die Datumsgrenze überschritten und mussten deshalb einen ganzen Tag überspringen. Besonders schön bei einer Weltreise gen Westen ist, dass man immer mal eine Stunde länger schlafen oder feiern kann. Immer dann, wenn die „MS Amadea“ in eine neue Zeitzone einfährt und die Uhr um eine Stunde zurückgestellt wird. Das ist logisch und alle kennen das Vor- und Zurückrechnen der Zeit beim Reisen. Aber die Sache mit der Datumsgrenze ist dann doch nicht so einfach, und es war sehr lustig, zuzuhören an Bord, wenn die Leute einander ganz fachmännisch die Logik dahinter erklärten und mittendrin hängen blieben oder sich total verfi tzten. Seit Beginn der Weltreise vor zwei Monaten fuhren wir von Nizza immer Richtung Westen, stellten die Uhr immer eine Stunde zurück, bis wir genau bei zwölf Stunden Zeitunterschied von zu Hause waren. Würden wir das weiter so machen, hätten wir bei unserer Rückkehr nach Hause eine völlig andere Zeit. Wir wären 24 Stunden zurück, hätten also ein anderes Datum als alle anderen. Ich fände das zwar absolut cool, aber na ja...
Die Lösung ist die Datumsgrenze. Wir haben also in der Nacht vom 17. auf den 18. alle unsere Uhren einfach 23 Stunden vorgestellt, statt einer Stunde zurück. Oder? Na warte mal - vor oder zurück? Ne, ne, stimmt schon. Deshalb sind wir statt in den Sonntag gleich in den Montag gewechselt und deshalb ist Korbinians Geburtstag am Sonntag einfach mal ausgefallen. Schön für den Sänger des Showensembles. Damit kann er so tun, als sei er nicht älter geworden. Schwierig für uns Gäste, denn wann singt man denn da das Geburtstagslied, wann gratuliert man, und die Geschenke gibt es dann am besten gar nicht. Sorry, Korbinian. Die Datumsgrenze ist eine imaginäre Linie auf dem 180-Grad-Meridian gegenüber dem Hauptmeridian in Greenwich. Auf dieser 1883 als Internationale Datumsgrenze eingeführten Linie, auf der sich Osten und Westen treffen, ändert sich also immer das Kalenderdatum. Wir auf der Reise nach Westen gingen einen ganzen Tag vor. Wer von der anderen Seite kommt, geht einen Tag zurück. Den Schlamassel hatten wir auf unserer ersten Weltreise. Wir fuhren anders herum und mussten laufend eine Stunde früher aufstehen. Dafür hatten wir dann einen Tag, also ein Datum, zweimal. Aber ich verzichte doch lieber auf einen ganzen Tag, als auf eine Stunde von der Nacht. Wie auch immer. Die Datumsgrenze verläuft als Zickzacklinie zum großen Teil durch den Pazifi k und richtet so kaum ein Durcheinander an. Nur in den Köpfen der Passagiere an Bord, wenn sie versuchen, die Sache zu erklären.
So wie ich gerade.

INSELN im Wind
Erst war es nur ein zartes Rosa über dem Meer. Dann wurde es heller. Ich lief über Deck 11 zur Spitze des Schiffes. Gerade rechtzeitig, um den ersten Strahl der Sonne über den Bergen von Moorea sehen zu können. Wie der Arm der Freiheitsstatue streckte er sich in den Himmel. Dieser Sonnenaufgang bei der Einfahrt in Moorea war eines der schönsten Erlebnisse. Am Anfang war ich allein an Deck. Doch nach und nach kamen andere Passagiere - verschlafen, manche im Bademantel, träge. Keiner störte diese friedliche Ruhe des Augenblicks. Das Schiff glitt lautlos der Insel entgegen. Die Sonne genoss scheinbar das Publikum und bot eine tolle Vorstellung. Mal versteckte sie sich hinter den Bergen von Moorea, mal schickte sie ein paar Strahlen hervor, mal bot sie ein gleißendes Licht, dass wir die Augen bedecken mussten und dann spielte sie mit den Farben. Sie tauchte die Wolken in unterschiedliche Rosa-. Rot- und Gelbtöne. Sie beleuchtete die Menschen an Deck liebevoll und verwischte harte Konturen und Sorgenfalten.
Und mit dem höchsten Berg der Insel, dem 1207 m hohen Tohiea, schmuste sie und lehnte sich scheinbar freundschaftlich an, bevor sie endlich ihren Weg nach oben startete. Die Luft war erfüllt vom Duft von Tausenden Blüten. „Riechst du das?“, fragte ich eine unbekannte Frau neben mir. Sie zog die Luft tief ein: „Dieser Duft ist unglaublich“, bestätigte sie. Es roch viel besser, als in einem Blumenladen. Süß, schwer, aber nicht erdrückend. Das Paradies auf Erden. Moorea gehört zu Französisch-Polynesien, das 1957 französisches Überseeterritorium wurde und mit 118 Inseln, die insgesamt knapp 4200 qkm Landfläche bilden, der bekannteste Teil der Südsee ist. Seit 1984 ist Französisch- Polynesien autonom, aber wirtschaftlich immer noch von Frankreich abhängig. Vom Gemüse bis zum Fleisch wird alles importiert, was das Leben auf den Inseln teuer macht. Auch für uns Weltreisende ist es auf unserer Tour das teuerste Gebiet, das wir durchqueren. Ein Cocktail auf Tahiti kostet über 20 Dollar - heftig.

Am bekanntesten in der Region sind die Gesellschaftsinseln, die sich in zwei Gruppen teilen. Die dem Passatwind zugewandten Inseln („Inseln im Wind“) und die abgewandten Inseln im Westen. Zur ersten Gruppe gehören Tahiti, Moorea und Tetiaroa, zur zweiten Gruppe Bora Bora, Huahine und Raiatea. Weil diese Inseln für pazifi sche Verhältnisse alle nah beieinander liegen, hatten wir mit der „MS Amadea“ zehn Landtage nacheinander. Beginnend mit unserer schönen Beachparty auf Fakarawa folgten Rangiroa, Bora Bora, Moorea, Tahiti (drei Tage), Huahine, wieder Bora Bora und Raiatea. Es klingt sicher völlig verrückt angesichts der Schönheit und Harmonie der Inseln, dass ich diese Zeit als stressig empfunden habe. Zehn Tage Ausfl üge, Landgänge, so viel sehen wie möglich. Wie schon mal gesagt: Luxus ist immer das, was man wenig hat. So gönnte ich uns den Luxus, auch mal nicht an Land zu gehen. Welcher Frevel! Ich weiß. Aber zu meiner Entschuldigung muss ich sagen, dass wir diese Inseln schon bei unserer letzten Weltreise besuchten und dann pfl ichtgemäß jede einzelne von der ersten möglichen Minute bis zum letzten Tenderboot ausgekostet hatten.
Es ist auf jeden Fall eine traumhaft schöne Gegend, die ich jedem Menschen empfehlen muss: Falls das mit dem Paradies nach dem Tod doch nicht klappen sollte, hat man hier auf Erden wenigstens ein Häppchen bekommen. Weiße Strände, blaue Lagunen, Fische zum „an die Nase stupsen“ und schöne Menschen. Die Gesichtszüge und schlanken Körper der Polynesier, deren Vorfahren Franzosen und chinesische Arbeitskräfte waren, vervollkommnen den romantischen Südseetraum, der immer noch diesen Hauch Exotik verkörpert. Immerhin ist die Südsee von Europa ganz schön weit weg - 24 Stunden ist man mit dem Flugzeug unterwegs. Welche Richtung man nimmt, spielt keine Rolle, entweder fliegt man über Amerika oder über Asien.

Das Kreuz des SÜDENS
Es hat immer noch etwas Faszinierendes für die Menschen - das berühmte Kreuz des Südens. Hoch steht es am Himmel, und immer wieder wurde es gesucht von den Menschen auf der „MS Amadea“. Am Abend ging die Arme in die Höhe und die Finger tippten gen Himmel. „Da!“ Oder: „Nein, dort“, stritten sich die Passagiere. Deshalb hatte der zweite Offizier des Schiffes, Andreas Slowik, sich der Suchenden angenommen und bot bei klarem Himmel immer wieder Sternenführungen an. Das „Crux“ oder eben „Kreuz des Südens“ leuchtet nur in der südlichen Hemisphäre und wandert in Jahreszeitenfolge von Ost nach West um den Himmelspol. Eigentlich sind es größere Sternengruppen der Milchstraße, die die Eckpunkte des Kreuzes darstellen und die wir nur jeweils als einen Punkt erkennen. Die fünffache Verlängerung der Längsachse zeigt den südlichen Himmelspol an, eine senkrechte Linie nach unten zum Horizont zeigt: Hier ist Süden. Aber den Mythos konnte ich durchaus verstehen. Für die Menschen, die früher in der Südsee lebten, war das Kreuz des Südens eine Überlebenshilfe in ihren Booten. Heute gehört es zur Südseeromantik wie die weißen Strände. Was ich auf dieser Reise auch gerade erst gelernt hatte: Es gibt eigentlich gar keine Südsee. Zumindest steht sie so nicht offiziell in den Fachbüchern der Geographen. Der Spanier Vasco Núnez de Balboa nannte das Meer zwar 1513 „Mar del Sur“, als er als erster Weißer hier her kam. Aber der richtige Name ist Ozeanien. Hauptsächlich waren es die Engländer und Franzosen, die die meisten Inseln hier entdeckten. Sie suchten die „terra australis incognita“ – ein geheimnisvolles Land irgendwo
im Süden. Der englische Kapitän John Byron entdeckte die erste Insel, Kapitän Samuel Wallis, ebenfalls Engländer, kam mit der „Dolphin“ und fand Tahiti, wo wenig später auch der Franzose Louis Antoine de Bougainville eintraf und es für Frankreich beanspruchte. Doch der berühmteste Südseeentdecker war immer noch der englische Kapitän James Cook, der von den Gesellschaftsinseln über die Fidschi-Inseln, Neukaledonien und Tonga die meisten Inseln als erster Europäer betrat.
Das wissen die meisten. Nur das mit Ozeanien – das war mir neu. Ich stehe ja immer zu meinen Wissenslücken, nur so kann man sie schließen. Ozeanien, das ich nur als Südsee kannte, liegt zwischen dem nördlichen und südlichen Wendekreis und umfasst 70 Millionen qkm, wovon eine Million qkm Inseln sind, auf denen 5,3 Millionen Menschen leben. Papua-Neuguinea ist dabei die größte Landmasse (780.000 qkm). Es gibt hier zwischen 8000 und 10.000 Inseln. Also brauchte ich mich nicht zu wundern, wenn nachts bei meinen Rundgängen immer mal wieder Lichter im Meer auftauchten oder an unseren Panoramafenstern in der Kabine plötzlich eine Insel „vorbeikam“. Nachdem wir in Polynesien waren und das sehr genossen, führte unsere Reiseroute nun nördlich Richtung Mikronesien. Der dritte Teil von Ozeanien ist übrigens Melanesien, „schwarze Inseln“. Dort sind wir bei unserer letzten Weltreise entlang gefahren, und ich war von diesen Inseln (dazu gehört auch Fidschi) nicht wirklich begeistert. Also war ich froh, dass sich ab jetzt die Reiseroute von unserer ersten Weltreise unterschied und ich in den nächsten Wochen auch endlich Neuland betrat. Die nächsten Destinationen waren Inseln, wo man, wie unser Kreuzfahrtleiter Christian Adlmaier es ausdrückt: „Sonst nie hinkam.“ Froh war ich, dass wir noch eine Weile meinem Liebling treu blieben – dem Pazifi schen Ozean, der mehr als ein Drittel der Erdoberfl äche einnimmt zwischen der Antarktis im Süden und der Beringstraße im Norden. Es war so ein angenehmes und sanftes „Getuckel“ hier, die Sonnenuntergänge waren nach wie vor überwältigend und die Farben des Meeres zwischen Türkis und Hellblau. Immerhin 32 Grad warm war das Meer, die Tage waren heiß und die Abende, an denen wir draußen neben dem Grillbuffet an Deck saßen, waren gemütlich. So konnte das Leben sein.

Pappardella und Wagner
Heute war Gala-Abend anlässlich der Hälfte des vierten Abschnittes unserer Weltreise. Das Motto war Moulin Rouge. Die Restaurants waren festlich geschmückt, auch die Kellner passend zum Thema gekleidet, die Küche hatte ein 9-Gänge-Menü vorbereitet und das Amadea-Showensemble eine entsprechende Vorstellung. Und ich? Ich saß auf meinem Balkon mit Parpadelle und Wagner...
Es war diese besondere Art der Freiheit auf einem Schiff, auf diesem Schiff. Es war diese besondere Form von Luxus, selbst zu entscheiden, was man gerade machen möchte. Ich war schon frisiert, gestylt und in Galarobe. Der Empfang vor dem Essen mit Musik und Sekt fand auf allen Etagen statt. Gerade wollte ich nach dem Sektglas greifen, das ein Kellner mir anbot, als ich dachte: „Warum?“ Ich war heute nicht im geringsten in Stimmung für eine Feier. Ist doch keiner jeden Tag. Zuhause gehört es zu meinem Job, zu Empfängen, Galas und Bällen zu gehen. Gesellschaftliche Verpflichtungen. Doch hier war ich keinem verpflichtet. Okay, ein schlechtes Gewissen hatte ich natürlich gegenüber der Küche, den Dekorateuren und Planern des Abends wegen ihrer Mühe - aber es würde keinem auffallen, wenn einer von der Vielzahl der Passagiere fehlen würde. Schließlich war ich nur irgendein Passagier und konnte genauso gut einen Abend mit mir und meiner Tochter allein verbringen.
Also fragte ich mich selbst, wonach mir der Sinn stand, und ich fand mich auf meinem Balkon wieder. Während Louisa im Bordfernsehen „Madagaskar“ schaute, bestellte ich zwei Gänge des Menüs auf die Kabine: Parpardelle mit Chardonnay Sauce und Kartoffel-Steinpilz-Lasagne mit Trüffelöl. Und weil ich, wenn es mir nicht wirklich gut geht, einen Hang zur Dramatik habe, gönnte ich mir zum Essen Wagner. Ich hatte den „Ring der Nibelungen“ auf meinem iPod und startete die Walküre. Ich liebe Wagner. Vor ein paar Jahren hatte mich der Sohn meiner Patentante eines Sonntages in die Dresdner Semperoper eingeladen. Nach dem ersten Schock, die Oper ginge fast fünf Stunden, war ich sofort in den Bann dieser Musik gezogen worden und war fasziniert von der Geschichte des Wandels. Wie die alte Götterwelt versucht, ihre Daseinsberechtigung zu behalten, wie sie kämpfen und letztlich untergehen. Weil es einfach eine andere Zeit ist, weil etwas Neues anbricht. Die Walküre war der erste Teil des Ringes, den ich eben damals an jenem Sonntag sah. Völlig unvorbereitet, nur eine grobe Vorstellung von Wagner und mit verschüttetem Schulwissen. Ich schlitterte hinein und fand mich schluchzend und schniefend wieder, als sich Wotan von seiner geliebten Tochter verabschiedete. Er liebte sie über alles, aber er verbannte sie und zog um sie diesen Feuerkreis. War mir das peinlich - Heulen in der Oper. Aber diese Kraft in der Musik, das Kämpferische, die Hoffnung und letztlich das Aufgeben und die Trauer. Wunderbar.
Und solch einen wunderbaren Abend gönnte ich mir auf meinem Balkon. Wissend, dass die anderen zusammen waren. Wissend, dass sie Spaß hatten und ich traurig war. Wissend, dass es völlig in Ordnung war, sich auch mal zurückzuziehen, um die Erlebnisse und die Gespräche zu verarbeiten. Und all das in der zehnten Etage über dem Pazifischen Ozean, beschienen vom Mond und begleitet vom Rauschen der Wellen mit Parpadelle und Wagner auf meinem Balkon. Es war okay, nur irgendein Passagier zu sein.

Der Deputy Premierminister und ich
Die Geschichte war verrückter, als sie sich ein abgedrehter Autor hätte ausdenken können. Schon mal was von Pretty Woman gehört? Ich habe es erlebt, nur dass der Mann kein Prinz war, sondern der Deputy Prime Minister von Samoa...
Der Tag begann nicht gut. Louisa war mit ihrem kleinen Freund Victor und dessen Eltern zur Rundfahrt auf Samoa unterwegs. Victor hatte Geburtstag und Louisa war sein Gast. Plötzlich stand ich nach dem Abschied und dem Winken mutterseelenallein auf Samoa und hatte keinen Plan. Ich wollte gerade frustriert ins Bett gehen, als eine Gruppe Einheimischer die Gangway betrat, gefolgt von einem Kamerateam. Mein Instinkt und meine Neugier trieben mich in ihre Richtung und - bling - saß ich mit ihnen in der Kopernikusbar. Kreuzfahrtleiter Christian Adlmaier stellte uns vor. „Das ist Misa, Telefoni Retzlaff, der Deputy Premierminister von Samoa.“ Ah, okay - na dann Prost!
Ich wollte schon immer mal mit einem Premierminister einen Drink nehmen. Der von Samoa auf Samoa? Bestens. Dazu kam, dass Misa, wie wir ihn nennen durften, Gefallen an uns und unserem Gespräch fand und mich anschließend gleich noch mit zum Essen in das Restaurant „Amadea“ einlud. Naja, er war ja selbst vom Kapitän und Kreuzfahrtleiter eingeladen, aber immerhin.
Misa fragte uns, ob wir gemeinsame Freunde hätten, zum Beispiel Ex-Finanzminister Hans Eichel. Klar, unsere Politiker sind doch alle unsere Freunde. Er erzählte von seinen Verhandlungen mit Heidemarie Wiecorek-Zeul und offenbarte uns seine positive Meinung über Angela Merkel. Kraft meiner Wassersuppe, wie meine Oma immer sagt, also mit der nötigen Portion an frecher Selbstüberschätzung gab ich mal dem Deputy Prime Minister von Samoa auf einem Schiff vor Samoa ein paar Tipps für seine Verhandlungen mit der deutschen Regierung. Innerlich lachte ich so laut, dass ich mir ein immer mal wiederkehrendes breites Grinsen nicht verkneifen konnte. Offensichtlich gefiel das dem Deputy Prime Minister von Samoa (sorry, aber ich muss diesen wunderbaren Titel immer wieder ausschreiben) und er begann, mir Gedichte aufzuschreiben. Sie erzählten von der Schönheit Samoas und er meinte, sie hätten auch für mich geschrieben sein können. So ein Charmeur.
Letztlich erzählte mir Misa Episoden aus seinem privaten Leben, von der Liebe und seiner Diät, die auf Seafood basierte und mit der er schon sechs Kilo abgenommen hatte. Was einem so ein Deputy Prime Minister eben erzählt. Wobei mir da natürlich auch mein Job half. Ich rede gern mit Leuten und die Leute reden gern mit mir. Als Gesprächspartner hatte ich schon viele Staatsoberhäupter, Könige und wichtige Politiker vor der Nase gehabt.

Trotzdem war die Situation hier auf Samoa eine ganz andere. Es war kein abgesprochenes Interview oder ein offizieller Staatsbesuch. Auf diesem Schiff war ich Anja, nicht die Disy-Chefredakteurin. Und in diese Situation war ich durch Zufall reingetrudelt. Wie es mir oft passierte auf solchen Reisen. Genau wie auf den Osterinseln. Erst läuft alles schief und daraus ergeben sich die verrücktesten Episoden. Und es wurde noch verrückter.
Während wir so zu dritt im Gespräch saßen, unterbrach uns der Deputy Prime Minister plötzlich und fasste mich am Arm: „Anja, das Fernsehen von Samoa möchte gern mit dir ein Interview machen.“ Genau. Das war das, was ich nun erwartet hatte. Ich drehte mich zu dem Kamerateam um, das den Prime Minister begleitet hatte und die Leute nickten. Nun gab es keine Steigerung mehr. Doch hatte ich nicht schon mal hier behauptet, es gäbe immer noch eine Steigerung (beim Bericht über die Beach-Party auf Fakarawa)? Da ich immer Recht habe, was meine Mitarbeiter zu Hause bestätigen können (liebe Grüße), gab es natürlich auch hier noch eine Stufe mehr. Aus dem Interview wurde eine Reportage über mich, wie ich als Special Guest of the Deputy Prime Minister of Samoa über die Insel geführt wurde und in Begleitung von jeweils 10 bis 12 Offiziellen die Sehenswürdigkeiten der Insel gezeigt bekam.
Zuvor gab Misa noch an meiner Seite ein Interview, in das er mich einbezog. „Lächeln und winken“ hatte ich von der Besatzung der „MS Amadea“ schon gelernt. Also lächelte ich und winkte im TV von Samoa. Dann begann unsere Tour über die Insel. Christian Adlmaier rief mir an der Gangway nach: „Vertritt Deutschland gut“ - und die Kameras gingen an.

Milas Traum
„Das ist der besondere Gast des Premierministers“, erklärte Mila mit Nachdruck. Im Robert Louis Stevenson Museum machte sich Aufregung breit. Die jungen Männer verbeugten sich, eine Frau rannte weg, um den Chef zu holen, und die anderen staunten mit großen Augen. Ich stieß Mila freundlich in die Seite und er grinste wie ich. Er kannte schließlich den Beginn dieser verrückten Geschichte...
Nachdem uns der Deputy Prime Minister von Samoa verkuppelt hatte, also die Reportage über meinen Besuch von Samoa arrangiert hatte, übernahm Mila die Führung. Er war Redakteur beim „SBC“, der „Samoa Broadcasting Corporation“. Von Beginn an war eine besondere Verbindung zwischen uns. Kein Wunder in dieser eigenartigen Situation. Der Deputy Prime Minister hatte uns einen Wagen mit Fahrer organisiert, und bevor wir zu unserer Tour über die Insel starteten, wollte Mila mir seinen TV- Sender zeigen. Also landete ich – schwupps – im Gebäude des TV von Samoa. Mila führte mich durch die Räume, stellte mich stolz seinen Kollegen vor, und plötzlich fand ich mich in einer Fachsimpelei mit der Chefredakteurin. Eben genau das, was ich mir am Morgen vorgestellt hatte: Kaffee mit Kollegen im TV-Studio auf Samoa.
Eine große Gruppe TV-Leute und offizielle Personen, vom Prime Minister mitgeschickt, begleiteten uns anschließend auf unserer Tour. Ich erfuhr, dass die Samoaner ihrem Land den Namen „The cradle of Polynesia - die Wiege von Polynesien“ gegeben hatten. Viele der 162.000 Einwohner haben deutsche Vorfahren, war doch West-Samoa zwischen 1899 und 1914 eine Kolonie des deutschen Kaiserreiches. Viele Namen der Samoaner klingen deshalb heute noch wie deutsche. Anders als der Name meines neuen Freundes Mila, der schon wieder leise witzige Kommentare in mein Ohr flüsterte, während er die Offiziellen mit ernstem Blick anschaute. Der war lustig und wir ergänzten uns perfekt in der Disziplin: „Wer kann sich am besten das Lachen verkneifen“. Unterwegs zeigt er mir die Überbleibsel aus der deutschen Zeit. Die Menschen auf Samoa mögen die Deutschen, was dem ehemaligen Gouverneur Wilhelm Solf zu verdanken ist. Er hatte in dem Inselstaat Schulen und Straßen bauen lassen, wovon noch einige existieren. Außerdem hat er zum Wohlstand der Insulaner beigetragen, weil er die Landrechte schützen ließ. Jeder Landbesitzer verpflichtete sich dazu, jährlich 50 Kokospalmen zu pflanzen. Noch heute stellen Kokosprodukte den größten Teil des Exportvolumens von Samoa. Als ich Mila zu seiner Meinung über den Deputy Prime Minister fragte, verdunkelte sich sein Gesicht und die Fröhlichkeit verflog. Was er mir erzählte war „offline“, was bedeutet, nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Im Marco Polo - Reiseführer über die Südsee las ich, dass das Gesellschaftssystem sehr traditionell ist und von alten Sitten und Gebräuchen bestimmt wird. Die Häuptlinge, die Matais, kontrollieren streng das Dorfleben. Bei den Parlamentswahlen 1991 wurde ein allgemeines Wahlrecht zugelassen, aber die Macht der Matais, auch politischer Art, ist offensichtlich immer noch sehr präsent. Eine eigenartige Sache waren auch die Faáfafine, die Transvestiten, die erzogen werden, um die Frauen bei der Hausarbeit zu unterstützen. Überhaupt sah ich hier viele Männer, die sich sehr weiblich bewegten und in ihrer Stimme und ihrer Art feminine Züge hatten.
Mila zeigte mir mehr von der Hauptinsel Samoas - Upolu. Hier leben 120.000 Menschen, gibt es im Osten und Süden schöne Strände und in der Nähe der Hauptstadt Apia, wo die „MS Amadea“ am Pier lag, das berühmte Robert Louis Stevenson Museum.
Dort spielten sich, wie überall und wie oben beschrieben, diese Szenen voll Ehrerbietung und Bewunderung ab. Noch nie in meinem Leben hatten sich an einem Tag so viele Menschen vor mir verbeugt. Als Special Guest vom Deputy Premierminister gab ich Autogramme, durfte Hände schütteln und alles wurde von den Kameras vom TV auf Samoa gefilmt. Immer im Scheinwerferlicht. Wie gesagt: „Lächeln und Winken.“ Die Queen machte es auch nicht anders. Ohne den ganzen Promi-Zauber hätte ich das Stevenson-Museum noch mehr genießen können. Es war ein fantastischer Platz. In dem Haus am Fuß des Mount Vaea hatte der Autor von „Dr. Jekyll und Mr. Hyde“ und der „Schatzinsel“ fünf Jahre gelebt, bis er 1894 im Alter von 44 Jahren an einem Gehirnschlag starb. Das Haus lag inmitten einer idyllischen Landschaft, hatte große Fenster und diesen besonderen Hauch der Inspiration. Ein leichter Wind wehte durch die großzügigen Räume und von der großen Terrasse aus hatte man einen malerischen Blick auf das Meer. Wie konnte ich Stevenson verstehen - dieses Haus animierte zum Schreiben. Am liebsten hätte ich mich an seinen Schreibtisch gesetzt und meinen ersten Bestseller verfasst. Ein Buch, das in diesen Räumen entstand, musste ein Erfolg werden.
Aber mich riefen die offiziellen Verpflichtungen: TV-Interview auf der Terrasse. Inzwischen war ein Bus mit Touristen angekommen, die alle warten mussten, bis ich das Haus verlassen hatte. In der Wartezeit schauten sie neugierig nach oben, um welchen Prominenten so viel Tamtam gemacht wurde. Vielleicht ein berühmter Showstar? Ein Staatsbesuch? Prinzessin hätte ich ihnen vorschlagen wollen. Dabei war es nur die Anja aus Dresden. Auf dem Weg nach Apia zurück fuhren wir an den Denkmälern für 150 amerikanische, britische und deutsche Marinesoldaten vorbei, die während eines Zyklons im Jahr 1889 auf ihren Schiffen ertranken. Zyklone und Taifune zerstören regelmäßig auf Samoa Siedlungen, Strände und Plantagen. Als ich Mila nach der Hilfe aus den westlichen Ländern fragte, antwortete er nicht und ich konnte nur vage ahnen, welchen Weg die Gelder auf Samoa nehmen. Mila zeigte mir noch das Parlamentsgebäude, wo die 52 Abgeordneten sitzen, bevor wir uns einen ruhigen Platz im berühmten „Aggie Grey´s Hotel“ suchten. Wir nahmen uns einen Tisch zu zweit und platzierten unsere Begleiter ein Stück von uns entfernt. Das Hotel, das die legendäre Aggie (starb 91-Jährig im Jahr 1988) in ihrer lebensfrohen und temperamentvollen Art geführt hatte, wird nun von den Nachkommen bewirtschaftet.
Mila und ich waren froh, dass wir nun ungestört reden konnten. Die besondere Verbindung zwischen uns hatte sich während der Rundfahrt mehr und mehr aufgebaut. Wir hatten einen gemeinsamen Humor, und ich mochte den Mann mit den weichen Zügen. Ich fragte ihn, ob er schon sein ganzes Leben auf Samoa wohne, und in seinen Augen sah ich bei der Antwort plötzlich so viel Schmerz, dass ich instinktiv seine Hand nahm. Ein ganzes Leben in diesem kleinen Inselstaat, mit einem Fünftel Einwohner, wie in meiner Heimatstadt... „Willst du nicht mal raus?“, fragte ich ihn und brauchte die Antwort nicht zu hören. Gerade als Journalist hatte man es schwer in einem kleinen Gebiet, besonders bei den erwähnten Machtverhältnissen.

Was ihn hier hielt? „Angst!“ Plötzlich wusste ich, warum ich nach Samoa gekommen war und was diese ganze abstrakte Konstellation mit dem Premierminister und der TV-Reportage sollte. Ich erklärte ihm, dass ich ganz sicher nur hier wäre, um ihm den nötigen Impuls zu geben, endlich das Leben zu leben, das er eigentlich wollte. Mila weinte. Ich erzählte ihm von meinen Erfahrungen und wie wichtig es war, sich nicht halbherzig mit Dingen zufrieden zu geben, die einen nicht wirklich erfüllten. Veränderungen erforderten immer Mut und - Aktion. Mila war neben dem Journalisten auch Lehrer. Die Finanzen waren das eine, da würde ich versuchen, ihm zu helfen. Das Überwinden der eigenen Angst war viel wichtiger. Samoa kannte er, aber „da draußen“ gab es doch noch so viel mehr ...! Die Verabschiedung war herzzerreißend. Ich spürte, dass Mila meine Hand am liebsten nicht mehr losgelassen hätte. Aber die nächsten Entscheidungen musste er allein treffen. Danach konnte ich ihm vielleicht helfen. Wenn er es wirklich wollte. Durch die Begegnung mit Mila hatte mein Besuch auf Samoa einen ganz anderen Nachklang, als man aufgrund der verrückten Erlebnisse mit dem Premierminister, als VIP oder im Fernsehstudio hätte denken können. Diese Menschen sind es, warum man Weltreisen machen sollte. Überlegen Sie mal, alles passierte an einem Tag und wir waren insgesamt 132 Tage unterwegs. Intensiver kann man das Leben nicht leben. Mila. I like you, too.

Funafuti in Tuvalu
Chuuk, Pohnpei, Nauru. Schon mal gehört? Eben... Wir hatten jetzt eine Strecke vor uns, auf der wir viele Einträge auf unserer besonderen Liste verzeichnen konnten. Nicht die Liste, wo wir noch nie gewesen waren. Auch nicht die, wo man nie hinkommt. Unsere Liste war die mit den am besten singbaren Weltreisezielen. Unsere heutige Station, das Atoll Funafuti im Land Tuvalu, lag knapp auf Platz zwei. Chuuk Chuuk, Chaak Chaak gab einen noch rockigeren Sound.
Samoa hatte mich geschafft. Die Besuche auf den nächsten Inseln musste ich etwas ruhiger angehen, obwohl die Namen Spaß versprachen. Tuvalu kennen zwar die Wenigsten, aber trotzdem haben viele etwas von Tuvalu. Sie wissen es nur nicht. Ich würde gern mit Ihnen eine Ratestunde veranstalten, aber ich bin gar nicht so und sage es Ihnen: Das Internetkürzel „tv“. Weil die Firma die Domain an TV-Sender in der ganzen Welt weiterverkaufte, war die Geschäftleitung zu hohen Summen bereit. Angeblich sollen 50 Millionen Euro geflossen sein. Beachtlich für ein Land mit 12.000 Einwohnern. Seit unserem Besuch auf Tuvalu zerbreche ich mir schon die ganze Zeit den Kopf, wem mein „AKF“ etwas nützen könnte. Nur 26 qkm groß ist Tuvalu und ist dennoch eines der Länder mit der weltweit höchsten Bevölkerungsdichte. Neun kleine Atolle gehören zum Land, die Böden sind kalkhaltig und nährstoffarm. Die Sprache heißt Tuvaluanisch – Louisa liebt dieses Wort (kann man übrigens auch gut singen). Allerdings kommt man mit Englisch gut voran, ist Tuvalu doch Mitglied des Commonwealth. Der Premierminister ist hier gleichzeitig Generalgouverneur und hat das Präsidialamt inne. Es ist eine sympathische Insel. Das wissen übrigens erst wenige Ausländer. In meinem Marco Polo - Reiseführer steht etwas von 200 bis 300 Besuchern jährlich. Wir mit der „MS Amadea“ haben dann also an einem Tag schon den Schnitt für die nächsten drei Jahre erfüllt.

Die kleinste Republik der Welt
Es ist nicht alles klein in Mikronesien - die Palmen sind hoch, die Herzlichkeit der Menschen ist überdimensional und die militärisch strategische Lage spielte und spielt eine große Rolle. Wir besuchten Mikronesien auf unserer Tour durch den Pazifik Richtung Japan ...
Das Wetter war schlecht. Die schönen Klischee - Sonnenuntergänge waren vorbei und mussten einer „Waschküche“ weichen. Feuchtigkeit, Schwüle, Wolken, warmer Regen und morgens eine Art Nebel. Wie immer schlug das Wetter auf die Gemüter, und so saßen nicht alle Passagiere in den Tenderbooten, die von der „MS Amadea“ nach Nauru, einem Inselstaat in Mikronesien, fuhren. Nauru, ein Atoll auf der Spitze eines erloschenen Vulkans, der bis 2000 Meter unter Wasser reicht, ist die kleinste Republik der Welt. Lange Zeit konnte die Einwohner vom Abbau von Phosphat leben, das sich aus den Exkrementen von Seevögeln bildete. Doch die Einwohner von Nauru hatten kein gutes Händchen bei der Anlage ihres Reichtums. Einst hatte Nauru das höchste Pro-Kopf-Einkommen der Welt und rutschte nach dem Ausschöpfen der Phosphatreserven in die Armut ab. Heute steht Nauru kurz vor dem Bankrott, doch von Resignation war nichts zu spüren. Mit viel Mühe und Aufwand begrüßten die Bewohner uns Besucher. Sie hatten Busse zur Verfügung gestellt und boten spontan und kostenlos Fahrten über die ganze Insel an. Sie demonstrierten Gastfreundschaft ohne Groll. Obwohl Nauru bis 2006 von der Umwelt isoliert war und aufgrund der hohen Gläubigerforderungen vor dem Verlust der Unabhängigkeit steht. Davon abgesehen droht der Insel ein weiteres schlimmes Schicksal. Wegen der globalen Erderwärmung und dem Anstieg des Meeresspiegels droht die Insel zu versinken. Doch die Einwohner jammern nicht oder klagen. Sie leben.
Auch auf Pohnpei, einem anderen Teil Mikronesiens, den wir zwei Tage später erreichten, war die Freundlichkeit der Menschen besonders. Ähnlich wie auf der Osterinsel gibt es auf Pohnpei ein unerklärtes Rätsel. Es sind die 10 Tonnen schweren Basaltblöcke der Ruinenstadt Nan Madol, die vor 1000 Jahren Kultzentrum war.
Chuuk, wieder zwei Tage später, war das letzte Atoll in Mikronesien, das wir besuchten. Es ist der weltweit beste Tauchplatz zu Schiffswracks und gilt als Unterwassermuseum. Hier liegt ein japanisches Versorgungsgeschwader, das 1944 von US-Fliegern versenkt wurde, in 20 Metern Wassertiefe. Die Geschichtsinteressierten von uns schauten sich die Überbleibsel aus dem 2. Weltkrieg an: Japanische Tunnel und Bunker. Ein österreichischer Passagier fand sich plötzlich als Lehrer in einer Schule von Chuuk wieder und dozierte über die Lage und Größe seines Heimatlandes - in was für Situationen man, wie schon oft erwähnt, auf solchen Reisen eben so rutschen konnte. Louisa und ich schwatzen mal wieder mit den Leuten. Wir ließen uns von ihrem täglichen Leben erzählen und begleiteten sie zu einer Petroleumstation, wo sie sich regelmäßig die benötigte Menge in Kannen und Eimer, für ihre einfachen Häuser abholten. Der amerikanische Einfluss war auf der Insel spürbar. Es gab Chips, Coca Cola und amerikanisches Eis. Um fünf Uhr am Nachmittag wurde der Anker gehoben und „MS Amadea“ nahm Kurs auf Guam. Dort sollten wir in zwei Tagen sein. Doch wir hatten die Rechnung ohne die Amerikaner gemacht.
Diese Amerikaner
Sie wollten uns nicht. Und offensichtlich haben sie das Recht, uns nicht zu wollen. „Welcome to Guam?“ Von wegen. Amerikanische Gastfreundschaft sieht anders aus.
Über Bordlautsprecher kündigte Kreuzfahrtdirektor Christian Adlmaier am Morgen vor Guam eine Sondersendung im „Amadea – TV“, dem bordeigenen Sender an. Dort erklärte er uns, dass wir Guam nicht wie geplant anlaufen würden. Erst hätten die amerikanischen Behörden sich Kopien aller Pässe mit Visa schicken lassen, dann hätten sie von plötzlichen Einreiseänderungen gesprochen und dass alle Passagiere und Crewmitglieder für Guam ein Visum bräuchten. Das war neu. Wir könnten Guam zwar anfahren, müssten dann aber pro Person mehr als 1000 Dollar Strafe zahlen und dürften nur im Hafen liegen. Kein Passagier und kein Crewmitglied dürfte vom Schiff egal ob mit oder ohne Visum. Aha! Der Kreuzfahrtdirektor versicherte, dass von Seiten des Veranstalters Phoenix Reisen im Vorfeld alles ordnungsgemäß organisiert wurde. Sogar, dass Phoenix, als die ersten Probleme auftauchten, mit Washington telefonierte. Keine Chance! „So etwas habe ich in 25 Jahren als Chefreiseleiter und Kreuzfahrtdirektor noch nicht erlebt“, schüttelte Christian Adlmaier verblüfft den Kopf. Tja, die Amerikaner dürfen das.
Um schon mal klar zu stellen. Ich mag Amerika. Ich habe einige Zeit in Boston bei einer Zeitung gearbeitet, später ein Jahr bei einem Fernsehsender in Hollywood. Das war mit die schönste Zeit meines Leben. Klar bin ich gegen die amerikanische Politik und deren Überheblichkeit. Aber das Land und die meisten Leute sind toll. Dazu stehe ich. Schade war es trotzdem. Louisa und ich hatten eine Tour durch den Dschungel Guams geplant, wollten ein Chamorro-Dorf besuchen (Chamorros sind die dunkelhäutigen Ureinwohner) und mit einem Katamaran fahren. Guam ist die größte Insel Mikronesiens (550 qkm) und gehört zu den USA. Heute sind die 130000 Einwohner amerikanische Bürger, 90 Prozent der Touristen dagegen sind Japaner. Die Japaner schätzen den zollfreien Einkauf im Freihafen. Es entstehen in rasantem Tempo Shopping Malls und Hotelanlagen. Wir fuhren dafür nun eben in für uns rasantem Tempo an Guam vorbei. Ob bewusst geplant oder nicht: Ich fand cool, dass kurz nach der Sondersendung auf Deck 9 ein russischer Frühschoppen stattfand und die Gäste ihren Ärger über die Amerikaner mit Wodka runter spülten.