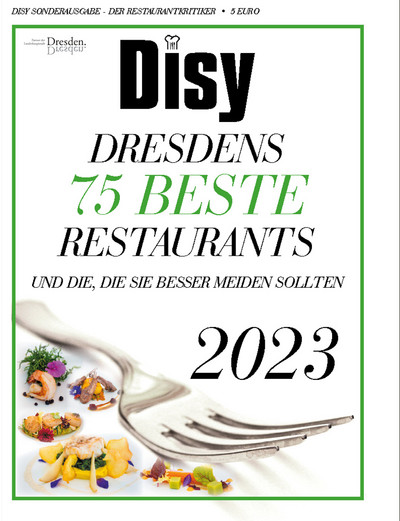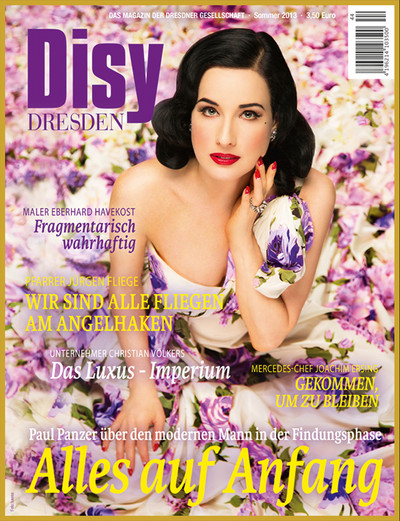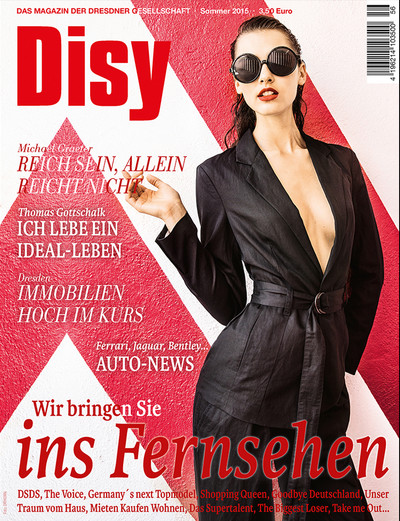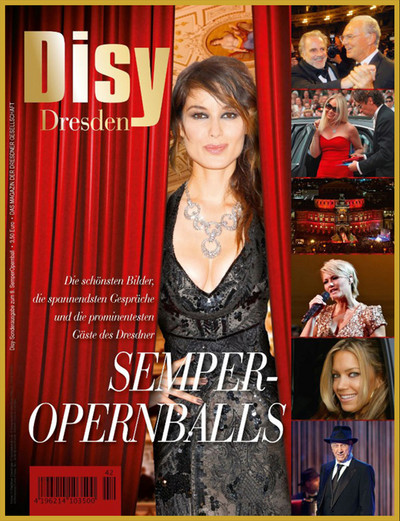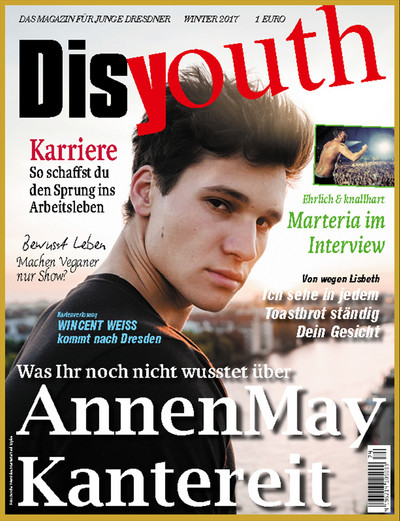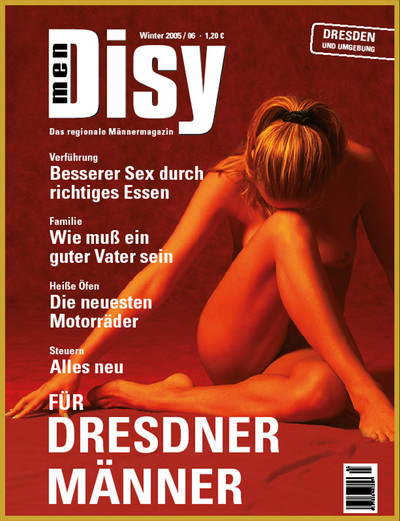- 4888 Aufrufe
Dresdner Kunst in Wroclaw

Identität vor dem Hintergrund von Migration – 10. OSTRALE präsentiert Dresden mit 64 Künstlern und Künstlergruppen in der europäischen Kulturhauptstadt 2016
Die Dresdner Kunstszene stellt sich in den nächsten Wochen mit der beeindruckenden Zahl von 64 zeitgenössischen Künstler und Künstlergruppen in der europäischen Kulturhauptstadt Wroclaw (Breslau) vor. Dieses außergewöhnliche Vorhaben wird im Rahmen eines Austauschprojektes von den Machern der 10. internationalen Ausstellung zeitgenössischer Künste Ostrale in Dresden organisiert. Die zweite Bürgermeisterin Annekatrin Klepsch und der Direktor der Museen der Stadt Dresden, Dr. Gisbert Porstmann sowie Andrea Hilger, Direktorin der Ostrale, werden die Ausstellung in Breslau am Freitag, dem 13.5., eröffnen.
„Dresdens zeitgenössische Kunst wird in beeindruckendem Umfang in der Europäischen Kulturhauptstadt und Partnerstadt Wroclaw präsent sein. Wir sind stolz, dass uns das, auch auf Basis der internationalen Ausstrahlung der Ostrale, gelungen ist. Das kann ein wertvoller Beitrag zu einer eventuellen Bewerbung Dresdens als europäische Kulturhauptstadt 2025 sein.“, so Annekatrin Klepsch, Beigeordnete für Kultur und Tourismus der sächsischen Landeshauptstadt.
Zahlreiche europäische Städte hatten vergeblich versucht, ihr zeitgenössisch-kulturelles Image in diesem Jahr mit einer Präsenz in der europäischen Kulturhauptstadt Breslau zu schärfen. Die Zusammenstellung der künstlerischen Positionen entstand in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Bildende Künste Dresden, der produzenten | galerie Dresden sowie der galerie sybille nütt Dresden. Die Ausstellung in Wroclaw dauert vom 13. Mai bis 31. Juli. Im Rahmen eines lebendigen Austauschprojektes werden dann, teilweise parallel, Künstler aus Wroclaw von 1. Juli bis Ende September auf der „Ostrale´O16“ in Dresden ausstellen. Die Ostrale ist eine internationale Ausstellung, die jährlich zeitgenössische Malerei, Plastik, Fotografie, Sound-, Licht-, Video-, Installations- und Performance-Kunst vereint, Kunst aller Genres im Dresdner Ostragehege präsentiert. „OSTRALE weht ODER“ nennen die Kooperationspartner ihr Projekt.
Identität von Menschen und Räumen angesichts von Flüchtlings- und Migrationsbewegungen
Die Ostrale greift mit der Ausstellung eines der zentralen Themen der Europäischen Kulturhauptstadt Wroclaw 2016 auf: die Frage nach der Identität von Menschen und neuen Räumen, die Flüchtlings- und Migrationsbewegungen in Vergangenheit und Gegenwart in der Region Niederschlesien als auch Sachsen, insbesondere Wroclaw und Dresden.
Der interkulturelle Austausch, vor allem mit den direkten Nachbarländern, gehört zu den wichtigsten Programmpunkten der Ostrale, sei es durch das Projekt „Out of OSTRALE“ oder durch das Artist-in-Residence-Programm, das Künstlern der Ostrale die Möglichkeit gibt, direkt vor Ort künstlerisch zu arbeiten und auf internationalem Boden miteinander zu kooperieren.
„Der Austausch mit der europäischen Kulturhauptstadt Breslau wird die Städtepartnerschaft Dresden-Breslau auf kultureller Ebene unterstreichen. In Dresden selbst werden wir ab 1. Juli wieder die Arbeit von ca. 160 Künstlern und Künstlergruppen aus ca. 42 Nationen in einer abwechslungsreichen Ausstellung kombinieren.“ so Andrea Hilger, Direktorin der Ostrale. Die diesjährige, 10. Internationale Ausstellung zeitgenössischer Kunst selbst findet vom 1. Juli bis 25. September in den historischen Futterställen und der Messe im Dresdner Ostragehege statt, das sich – auch durch die regelmäßige Nutzung der denkmalgeschützten, aber verfallenden Anlagen des ehemaligen Erlwein’schen Schlachthofes – inzwischen zu einem lebendigen Areal gewandelt hat.
Inhalte der Ausstellung in der Kulturbrauerei Wroclaw
- aus dem Programm -
OSTRALE weht ODER – Artysci z Drezna we Wroclawiu Ausstellung im Browar Mieszczanski
Die OSTRALE´O16 präsentiert sich unter dem Leitgedanken error: X, ein Begriff, der uns im digitalen Zeitalter öfter begegnet, als uns vielleicht lieb ist. Die Masse an Informationen und Meinungen hat sich zu einem unübersichtlichen Datendschungel verwachsen, dem die nachfolgende Generation mit Selfiesticks bewaffnet gegenübersteht, während die Heimatfront fröhlich Bilder vom Abendessen postet. Aber es gibt auch Grund zur Hoffnung. Die Vernetzung ist unmittelbarer als jemals zuvor. Es gibt die Idee eines globalen Miteinanders und das Internet ist das Werkzeug, mit dem wir den Mühlrädern unserer Zeit einen Stock in die Speichen werfen können.
Kunst ein Mittel der Kommunikation, dem das Wort als Verständigung fehlen darf. Sinnliche, empirische, auch empörte Wiedergabe und Wahrnehmung unserer Sucht nach Worten. Die Subjektivität künstlerischer Äußerung steht dabei – frei von äußerer Zweckgebundenheit und Instrumentalisierung – für die Tiefe seiner Bedeutung. Das spukhafte und humorvolle Spiel mit Machtstrukturen und Ideologien, mit Werten und Wert in der Kunst.
Einige Beispiele der künstlerischen Positionen der Ausstellung:
In den Bierräumen der Browar sieht Kirsten Kaiser, mit „Aquagon = Wasser Ein Becken“, eine überdimensionierte Form. Leere Räume, leere Becken der Browar Mieszanski (Kulturbrauerei) bieten Raum für Gedanken. Es bleibt beim Betrachter, ob er an Bier denkt oder an das Wasser, welches unmittelbar mit dem Bierbrauen in Verbindung steht. Wenn man den „Aquagon“ im Becken sieht, ist das Flüssige, welches einst im Überfluss vorhanden war, schon abgelaufen.
Oder Matthias Lehmann, der die permanente Flut an Informationen die täglich auf uns einprasseln in Form von Nachrichten, Schlagzeilen, Werbung, E-Mails, SMS, Twitter-Kurznachrichten, als Veränderung unserer Umgebung sieht. Sie verdrängt das, was zuvor da war, oder an Stelle dieser gewesen wäre. Doch das Chaos, das Zuviel von Dingen kann auch Kreativität und Ideenreichtum hervorbringen, indem Dinge miteinander kombiniert werden, die nur im Chaos zueinander finden.
OSCAR HR zeigt in einem Video-Loop den syrischen Künstler Manaf Halbouni, beim Schwingen einer Fahne, die durchgängig ihre Farbe ändert. Die Videoarbeit sucht nach der Möglichkeit einer konzilianten Botschaft in einer humanitären Krise und nutzt ein Symbol, welches jeden Bürger unabhängig seiner Farbe, Nationalität oder Parteiangehörigkeit repräsentiert.
Manaf Halbouni selbst wiederum sieht in der Deutschen Umgangssprache „Wir warten, bis Gras darüber wächst“ seine Arbeit Shahida „Witness“ ein zerfallenes arabisches Grab, das trotz Zerstörung weiter steht und daran erinnert, dass einst etwas Schreckliches passiert ist. Der Wille zum Leben ist stärker und unaufhaltsam: Die Natur überlebt fast alles und deckt mit ihrer grünen Pracht ein Ereignis, welches neuen Generationen den Willen zum Weitermachen gibt.
Jens Küster greift den Aspekt der Verwobenheit von Identitätszuschreibungen auf, welche ihm bei der Lektüre über Wroclaw in den Sinn kamen. Die Vermischungs- und Verwobenheitsgeschichte der Stadt berührte ihn, weil es gerade so einen direkten Bezug zu Entwicklungen in Europa gibt – den Umgang mit Kulturvermischungen.
Anke Ewers zeigt visualisierte Denkräume, in denen jede Idealisierung des Verhältnisses von Natur und hergestelltem Objekt nicht mehr zu existieren scheint.
In Eberhard Bosslets Lichtinterventionen verändert er die Nachtwirkung von markanten Stadtbildsituationen. Von innen heraus zieht das unregelmäßige, arhythmisch flackernde Licht die Aufmerksamkeit auf sich und hinterfragt so die Erscheinungskonvention.
Till Ansgar Baumhauer behandelt die Thematik des radikal-islamischen Glaubenskampfes.
Nadine Baldow spricht von der Beziehung zur Natur als großes Thema. Wie wird die Natur durch den urban geprägten Menschen wahrgenommen und eingeordnet? Sehen wir uns noch als Teil der Natur oder ist sie für uns schon zu einer Art abstrakten Vorstellung geworden?
Frank Hermann stellt die Frage, ob wir als Rivalen geboren wurden oder Wesen sind, die empathisch und solidarisch handeln können.
Tobias Köbsch zeigt Nahaufnahmen von vermummten Köpfen. Die mit Plastiktüten und hinter Marken-Labels und Flaggen verborgenen Personen befinden sich im Spannungsfeld des „nicht sehen könnens“ und des „nicht gesehen werdens“. Dieser Zustand beschreibt ein fatales und womöglich unlösbares Problem der gegenwärtigen Medien- und Informationsgesellschaft.
Stephan Popella spiegelt die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen, politischen Phänomenen und Ereignissen wider. In welcher Beziehung stehen die Protagonisten zu einander? Welche Position fällt dabei dem Einzelnen zu? Die Frage nach den Handlungsspielräumen der Elemente innerhalb dieser Komposition wird gestellt.