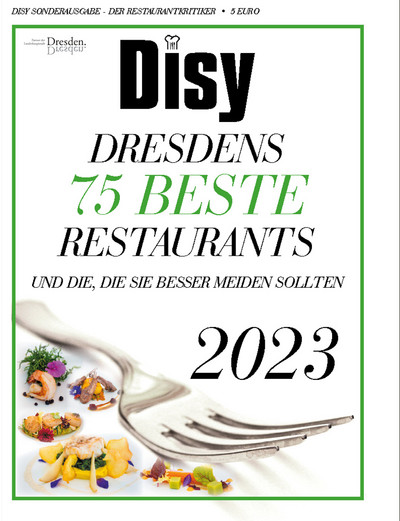- 3791 Aufrufe
Editorial Frühling 2009
Ich mag es zwischen den Menschen in meiner Redaktion, in meiner Familie und vor allem in der Stadt gern harmonisch. Aber ich habe gelernt, es ist nicht möglich, alle gleichzeitig glücklich zu machen. Schreibt man etwas Nettes über den einen, ärgert sich der andere. Stellt man einen vor und den anderen nicht, ist der andere sauer. Der eine möchte, dass wir eine Sache veröffentlichen, und der andere nicht. Es ist mir klar, dass Journalisten sich darum sonst nicht wirklich kümmern. Sie haben eine Geschichte, dann wird sie gedruckt – basta! Das ist im Tagesgeschäft legitim, und Medien sollten auch ein Regulativ für die Gesellschaft sein. ABER: Wir sind anders! Zum einen, weil wir oft auf brisante Geschichten verzichten, zum anderen, weil wir Informationen auf Wunsch oft so lange zurückhalten, bis irgendein regionaler Schreiber sie nach Monaten dann doch auch erfährt und eine Exklusiv-Geschichte daraus macht, die dann schon lange keine mehr ist.
Natürlich hat es auch seinen Vorteil, das Netz hinter dem Netz zu durchschauen, still den Überblick in der Stadt zu haben und sich manchmal auch ein wenig zu amüsieren. Man sollte doch nicht glauben, womit sich wichtige Menschen in Vorstandsetagen und Geschäftsführerbüros neben ihrer Arbeit ausführlich beschäftigen: Da geht es wirklich darum, wen wir bei Aufzählungen namentlich in welcher Reihenfolge genannt haben, welche Namen beieinander stehen, wer auf welchen Fotos gut aussieht und wer schlecht getroffen wäre (wobei wir immer auf vorteilhafte Fotos achten). Es wird geschimpft über die Konkurrenten in den jeweiligen Branchen, auf den Nachbarn, der es angeblich gar nicht verdient hat, so groß im Foto zu sehen zu sein, und es wird über Leute gehetzt. „Das wäre mal ‘ne Geschichte für Sie", heißt es dann.
Können sich nicht alle einfach vertragen? Ist es nicht möglich, den anderen neben sich so leben zu lassen, wie er es möchte? Ausschreibungen, Kämpfe um Projekte und Gelder, eine hohe Marktdichte in vielen Branchen, schwere wirtschaftliche Zeiten – schon klar, dass auf uns allen ein besonderer Druck lastet. Aber das Ventil dafür sollte ein anderes sein, als Wut oder gar Hass auf den Mitbewerber. Schließlich ist er einem ähnlich, hat gleiche Interessen und vielleicht ähnliche Ideen, sonst wäre er kein Mitbewerber.
Nun, ich stehe natürlich nicht über den Dingen, und mal einen sprachlichen Seitenhieb auf den einen oder anderen schließe ich bei mir selbstverständlich auch nicht aus. Sicher schwatzt man über andere, zumal wenn sich in einer Stadt wie Dresden in den meisten Kreisen alle untereinander kennen. Wir sind Menschen. Aber es sollte doch einen bestimmten Zeit-, Energie- und Anstandsrahmen nicht sprengen.
In unserer Branche ist es eigentlich sehr angenehm. Zwar gilt Dresden als der zweithärteste Zeitungs- und Zeitschriftenmarkt Deutschlands (Mediendichte, Themenbelegung; der härteste ist Berlin), und wer jetzt noch neu dazukommen möchte, hat von Beginn an verloren. Aber über die Jahre hat sich ein sehr kollegiales Gegeneinander eingespielt. Von mir aus könnte es auch ein Miteinander sein, aber so realistisch bin ich dann doch. Der Markt ist seit Langem aufgeteilt, die Nischen sind jeweils kompetent besetzt, und meiner Meinung nach ist genug für alle da. Gut, wir sind vom täglichen Kampf um Auflagen am Kiosk und vom Umsatzdruck durch Vorstände großer Verlage verschont und deshalb sicher noch entspannter als andere. Trotzdem empfinde ich den Umgang in unserer Branche als friedlich bis freundschaftlich, respektvoll und manchmal sogar gegenseitig anerkennend.
Das wünsche ich mir für die ganze Stadt: stolz auf die Erfolge des Nachbarn sein, Vorsprünge des anderen als Ansporn für die eigene Kreativität sehen, nicht über Mitbewerber oder andere Menschen herziehen, Kritik direkt ansprechen und vor allem die Priorität auf das eigene Geschäft und das eigene Leben legen.
In diesem Sinne
Ihre
Anja K. Fließbach