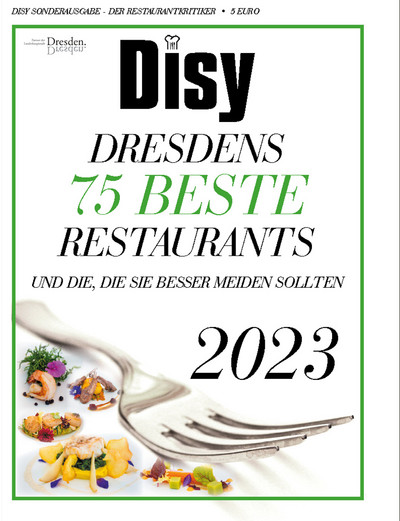- 3789 Aufrufe
Warum die Dresdner führend sind

Die Urologische Universitätsklinik in Dresden ist eine der am besten ausgestatteten ihrer Art. Modernste Technik, eigene Studien und professionelles Personal tragen zum guten Ruf bei. Wir sprachen mit Prof. Dr. med. Dr. h.c. Manfred Wirth über die neuesten Erkenntnisse bei verschiedene Krebsarten, neue Ansätze in der Immuntherapie, heilende radioaktive Mittel, Nierentransplantationen und wieso lebensrettende Medikamente nicht zu Ende entwickelt werden.
"Wenn Sie heute in Altersheime gehen, sind dort über die Hälfte der Patienten inkontinent. Das ist eins der häufigsten Gesundheitsprobleme, weil es durch die vielen Hilfsmittel, die ein Betroffener braucht, auch sehr teuer ist."
Die Urologie in Dresden ist eine der am besten ausgestatteten ihrer Art. Modernste Technik, eigene Studien und professionelles Personal tragen zum guten Ruf bei. Wir sprachen mit Prof. Dr. med. Dr. h.c. Manfred Wirth über heilende radioaktive Mittel, die Ursachen von Blasenkrebs und wieso lebensrettende Medikamente nicht zu Ende entwickelt werden. Wie viele Patienten behandeln Sie pro Jahr?
Prof. Wirth: Letztes Jahr hatten wir knapp 5.000 Patienten, dieses Jahr werden es noch mehr. Was die stationäre Patientenbehandlung angeht, sind wir die größte Urologie in Deutschland.
Sind die meisten davon Krebsfälle?
Prof. Wirth: Wir haben ein sehr breites Spektrum, im Grunde behandeln wir den gesamten Bereich der Urologie. Allerdings nehmen dort Krebserkrankungen einen bedeutenden Stellenwert ein. Ungefähr knapp 30 Prozent der bösartigen Tumoren bei Mann und Frau liegen im Gebiet Urologie, was einem sehr hohen Anteil entspricht.
Was für Krankheiten behandeln Sie noch?
Prof. Wirth: Missbildungen sowie Rekonstruktion von Organen im urologischen Bereich. Missbildungen bei Kindern sind im Übrigen gehäuft im Bereich der urologischen Organe anzutreffen.
Womit hängt das zusammen?
Prof. Wirth: Das liegt daran, dass die Nieren und die Harnwege im Rahmen der Entwicklungsgeschichte kompliziert aufgebaut sind. Die Harnröhre kann gerade bei Jungen ein großes Problem sein, dort liegen die häufigsten Missbildungen überhaupt.
Welche weiteren Felder sind wichtig?
Prof. Wirth: Außer der Kinderurologie haben wir noch den gesamten Bereich der Blasenschwächen bei Frau und Mann. Auch Männer haben da Schwierigkeiten, zwar andere als die Frauen, aber 70 Prozent der Männer im Alter von 70 Jahren haben Probleme mit ihrer Blasenfunktion. Wir kümmern uns auch um sogenannte Männer-Probleme, also zum Beispiel Potenzstörungen oder Testosteronmangel, diese sind im Alter nicht selten.
Ein großer Komplex bei Ihnen sind auch rekonstruktive Techniken, die größtenteils nur in großen Zentren gemacht werden können...
Prof. Wirth: Ja, neben den genannten Fehlbildungen nehmen wir zum Beispiel auch Rekonstruktionen nach Strahlenschäden, schweren Unfällen, Tumoroperationen an der Niere, Blase, Harnleiter oder Harnröhre vor.
Welcher Methoden bedienen Sie sich da?
Prof. Wirth: Wenn bei einem Unfall oder ob Strahlenfolgen etwas verletzt wurde, müssen wir z. B. teilweise den Harnleiter durch Darm ersetzen. Oder wir bilden aus Darm neue Blasen.
Stimmt es, dass die Harnröhrenchirurgie einen wichtigen Stellenwert bei Ihnen einnimmt?
Prof. Wirth: Ja, besonders da, wo auch eine Rekonstruktion nötig ist, zum Beispiel bei Narbenbildung. Früher war das sehr schlimm. Viele Geschlechtskrankheiten, wie z. B. die Gonorrhoe, gingen mit Harnröhrenvernarbungen einher. Erkrankte Männer konnten dann oft nicht mehr urinieren, weil die Harnröhre verschlossen war.
Wie helfen Sie da heute?
Prof. Wirth: Heute kann man das mit entsprechenden rekonstruktiven Eingriffen gut lösen. Man ersetzt zum Beispiel die Harnröhre durch Mundschleimhaut oder durch Haut.
Das ist sicher heute sehr selten.
Prof. Wirth: : Naja, es kommt heute nicht mehr durch Gonorrhoe, sondern durch andere Dinge, wie Entzündungen, Unfälle oder nach Kathetereinlagen. Das ist durchaus ein häufiges Problem. Die Harnröhre beim Mann ist sehr lang und an bestimmten Stellen kann es zu Entzündungen kommen. Dann entstehen Narben. Frauen sind davon weitestgehend verschont.
Wie können Sie Inkontinenz heute behandeln?
Prof. Wirth: Bei Frauen geht es darum, die ursprüngliche Anatomie wieder herzustellen. Häufig machen wir das inzwischen auch Roboterassistiert. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wenn der Vorfall zum Beispiel nah bei der Scheide ist, dann fixieren wir sie. Das kann man von innen vornehmen oder mit Bändern von außen. Allerdings sind Bänder nicht ganz unproblematisch, da sie Fremdmaterial darstellen, das in die Scheide hineinwandern kann, dann also offen liegt. Das ist natürlich sehr ungünstig.
Operieren Sie deshalb lieber von innen?
Prof. Wirth: Das ist zwar ein etwas größerer Eingriff, aber wenn man das Roboter-assistiert operiert, geht das eigentlich auch sehr gut. Die Ergebnisse sind insgesamt dann wirklich gut.
Wie sieht das bei Männern aus?
Prof. Wirth: Wenn Männer inkontinent sind, hängt das meistensmit Operationen oder Bestrahlung zusammen. Häufig hilft in dem Fall nur ein künstlicher Schließmuskel. Den kann man einsetzen und der stellt dann die Kontinenz wieder her. Das funktioniert bei etwa 95 Prozent der behandelten Männer.
Und wo liegt die Ursache bei den Frauen?
Prof. Wirth: Das ist in der Regel eine Beckenbodenschwäche, die häufig in Zusammenhang mit der ersten Geburt steht. Wenn die Frauen nach der Geburt keine gute Beckenbodengymnastik machen, ist das Risiko für eine spätere Inkontinenz erhöht. Es gibt jedoch auch Frauen, bei denen das Bindegewebe per se schwach ist.
Kommt das häufig vor?
Prof. Wirth: Ja. Wenn Sie heute in Altersheime gehen, sind dort über die Hälfte der Insassen inkontinent. Das ist eines der häufigsten Gesundheitsprobleme. Betroffene brauchen viele Hilfsmittel, die sehr teuer sind. Das beste wäre, sich fit zu halten, damit sich Inkontinenz gar nicht erst entwickelt. Das kann man nur empfehlen.
Gibt es noch mehr Erkrankungen in Ihrem Bereich, die man vermeiden könnte? Prof. Wirth: Da gibt es viele. Der Blasenkrebs hängt zum Beispiel im Grunde vom Rauchen ab, da könnte man sehr viel machen. Bei Männern gibt es auch einen Zusammenhang zwischen Prostata- Krebs und der Ernährung. Auch beim Nierenkrebs scheint das Rauchen eine Rolle zu spielen.
Ist die Ursache bei Prostata-Krebs bewiesen?
Prof. Wirth: Eindeutig bewiesen ist das nicht. Aber wenn zum Beispiel Japaner in Japan leben, ist die Häufigkeit von Prostata-Krebs sehr niedrig. Wandern sie aber nach Amerika aus, haben sie in der zweiten Generation die gleiche Häufigkeit von Prostata-Krebs wie die dort lebenden Amerikaner - und die ist dort sehr hoch, etwa zehnmal höher als in Japan. Da sich die Menschen in beiden Ländern ganz unterschiedlich ernähren, wird es wahrscheinlich damit zusammenhängen.
Was sollte man also vermeiden?
Prof. Wirth: Wir vermuten, dass es hauptsächlich tierische Fette und Eiweiße sind, zum Beispiel auch rotes Fleisch. Es gibt keine Studien, mit denen man das bisher eindeutig belegen kann, aber diese Tatsache ist sehr evident. Es gibt zum Beispiel auch in Europa ein Nord-Süd-Gefälle der Erkrankung, Prostata-Krebs kommt im Norden weitaus häufiger vor.
»Prinzipiell ist Krebs am besten geheilt, indem man ihn entfernt.«

Welche Möglichkeiten haben Sie heute, diese Krebserkrankungen zu behandeln?
Prof. Wirth: Prinzipiell ist es so: Krebs ist am besten geheilt, indem man ihn entfernt. Die Alternative dazu ist die Strahlentherapie. Bei der Strahlung hat man aber das Problem, dass bei einer noch langen Lebenserwartung des Patienten auch wieder Zweittumore verursacht durch die Bestrahlung entstehen können. Die Rate an Darm- und Blasenkrebs verdoppelt sich nach ca. zehn Jahren, wenn Sie eine Bestrahlung der Prostata vornehmen, und die Schere geht jedes Jahr weiter auf.
Aber die Chemotherapie ist ja auch ein zweischneidiges Schwert...
Prof. Wirth: Es gibt die konventionelle Chemotherapie, die zum Beispiel bei Hodentumoren extrem effektiv ist. Das ist der Tumor, der am besten behandelbar ist. Dort können Sie auch im metastasierenden Stadium noch über 90 Prozent der Patienten heilen, das gibt es bei Krebs sonst eigentlich kaum.
Gibt es denn inzwischen endlich wirkungsvolle Alternativen?
Prof. Wirth: Prostata-Krebs kann man zum Beispiel auch hormonell behandeln. Dort sind in der letzten Zeit eine ganze Reihe neuer Behandlungsmethoden dazugekommen. Es gibt viele neue Medikamente, mit denen man unter anderem die Knochenmetastasen behandeln kann. Die Firma Bayer hat da kürzlich ein ganz neues, sehr effektives Mittel auf den Markt gebracht.
Alpharadin?
Prof. Wirth: Genau, es ist sozusagen ein radioaktives Medikament, das sich in die Osteoblasten setzt und dort die Tumorzellen bestrahlt, die dann absterben. Das ist eine sehr interessante Geschichte, genau wie die neuen Hormontherapieformen, die das Testosteron weitgehend abschalten. Das Problem ist, dass die Prostata-Krebszelle es jedoch immer wieder schafft, neue Wege zu finden, sich zu stimulieren. Man kommt immer nur eine Weile dagegen an. Wir sind noch nicht darauf gekommen, wie wir das verhindern können.
Ist das gerade bei Prostata-Krebs besonders?
Prof. Wirth: Bei anderen Tumoren ist das ähnlich. Beim Nierenzellkarzinom haben wir viele Substanzen, mit denen wir heute die Blutversorgung und das Wachstum verhindern können. Dazu gibt es inzwischen eine ganze Reihe von Medikamenten, die wir vor zehn Jahren noch gar nicht hatten. Aber damit kann man immer nur das Leben um eine gewisse Zeit verlängern, man kann die Patienten mit diesen Substanzen nicht wirklich heilen. Mit den Hormonen ist es genauso.
Das klingt ernüchternd.
Prof. Wirth: Nur mit der Chemotherapie können wir den Krebs bei bestimmten Patienten heilen. Das geht jedoch wie gesagt bei Prostata- und Nierentumoren nicht, nur beim Hodentumor funktioniert es gut. Wahrscheinlich hängt das mit den Stammzellen zusammen, die durch die Chemotherapie nicht zu zerstören sind.
Und beim Blasenkrebs?
Prof. Wirth: Beim Blasenkrebs heilt man, wenn er metastasiert ist, mit der Chemotherapie weniger als fünf Prozent. Wenn wir zu spät kommen und nicht mehr operieren können oder nicht alles komplett entfernen, sind wir bei den meisten Krebsarten sehr limitiert.
Muss man also abschließend attestieren, dass man fortgeschrittenen Krebs nur mit der Chemotherapie besonders effektiv bekämpfen kann?
Prof. Wirth: Bisher gehen wir davon aus, dass wir nur mit Chemotherapie metastasierte Erkrankungen im Bereich der Urologie heilen können. Auch Tyrosinkinase-Inhibitoren und ähnliche Substanzen helfen auf Dauer nicht. Aber es gibt sehr interessante neue Ansätze in der Immuntherapie. Damit können wir langfristige Erfolge erzielen, weil der Angriff auf die Tumorzelle weniger gestört werden kann. Die Zelloberfläche, die immer vorhanden ist, wird direkt attackiert. Dort gibt es neue Möglichkeiten, die meines Erachtens zurzeit mit am erfolgversprechendsten sind, sowohl beim Prostatakrebs, als auch bei anderen Tumorerkrankungen.
Wie sieht es dort mit dem Stammzellen- Problem aus?
Prof. Wirth: Die Stammzellen haben ja auch die entsprechenden Antigene angelegt, also werden auch sie durch die Immunzellen attackiert. Und wenn die Immunzellen einmal da sind und die Stammzellen wieder anfangen, zu wachsen, greift die Immuntherapie sofort an. Also sind wir auch dann in der Lage, die neuen Krebszellen abzutöten.
»Teilweise werden Medikamente gar nicht zu Ende entwickelt, weil es heute viel zu teuer ist, sie zuzulassen. Vor zehn oder 15 Jahren kostete die Zulassung vielleicht 100 Millionen, heute kostet es über eine Milliarde. Das ist Wahnsinn!«
Wie lange dauert es, bis das in der Praxis eingesetzt wird?
Prof. Wirth: Dazu laufen derzeit Studien. Es gibt aber schon Immuntherapien beim Prostata-Krebs, die in den USA schon zugelassen sind, zum Beispiel eine, die auf dendritischen Zellen basiert mit dem Wirkstoff Sipuleucel-T. Dort wird im Moment eine Menge geforscht.
Aber genau kann man es noch nicht sagen?
Prof. Wirth: Nein, aber das ist die Richtung, in die es geht. Heutzutage dauern solche Zulassungen sehr lang. Teilweise werden Medikamente gar nicht zu Ende entwickelt, weil es heute viel zu teuer ist, sie zuzulassen. Vor zehn oder 15 Jahren kostete die Zulassung vielleicht 100 Millionen, heute kostet es über eine Milliarde. Das ist Wahnsinn! Man hat versucht, alles sehr sicher zu machen. Aber damit ist es vor allem auch viel zu kompliziert und teuer geworden. Wenn die Firmen keinen Return on Investment sehen, brechen sie die Entwicklung ab, weil das Risiko zu hoch ist.
Obwohl man theoretisch mehr Krankheiten heilen könnte?
Prof. Wirth: Ja, wenn man heute das Fünf- oder Zehnfache investieren muss, um ein Medikament voll zu entwickeln, ist es natürlich logisch, dass nur ein Fünftel oder ein Zehntel überhaupt in die Entwicklung gehen. Die Anforderungen an die Studien wurden von der Europäischen und Amerikanischen Zulassungsbehörde immer mehr vervollkommnet, um das Risiko so weit wie möglich zu minimieren, dies ist dann natürlich extrem teuer. .
Sie führen in Dresden auch viele Studien durch. Dann sind Sie von den Änderungen ja direkt betroffen...
Prof. Wirth: Wir haben hier eine große Studienzentrale und inzwischen drei Study Nurses und eine Ärztin, die sich nur um die Studien kümmern. Meistens bin ich der Principal Investigator und muss ständig Meldungen unterschreiben. Jeden Tag habe ich einen Ordner Material, was nur die Studien betrifft. Teilweise ist es gar nicht mehr möglich, sich alles im Detail anzuschauen. Zum Großteil ist das aber auch nicht nötig, weil es nur um Bürokratie und Absicherung geht. Meines Erachtens müsste dringend mal auf den Prüfstand, ob sich das wirklich bewährt hat. Inzwischen leben sogar riesige Unternehmen davon, Medikamente nur zu testen. Früher gab es das nicht.
Was für Studien laufen hier bei Ihnen in der Klinik?
Prof. Wirth: Wir testen in ganz verschiedenen Gebieten, zum Beispiel Prostata-Krebs, aber auch bei Blasen- und Nierentumoren. Wir haben aber auch Studien zur Kontinenz und zur Antibiotika-Testung.
Welche Fragestellungen bearbeiten Sie da?
Prof. Wirth: Im Tumorbereich geht um die Wirkung neuer Substanzen. Dort machen wir Phase 1, 2 und 3 Studien. Oder wir testen neue Antibiotika bei Infektionen. Es werden auch gerade eine Menge Medikamente gegen Inkontinenz bei Frauen untersucht. Das sind Studien, die dann auch weltweit durchgeführt werden.
Wie viele Studien betreuen Sie gleichzeitig?
Prof. Wirth: Mehr als zwanzig. Wir haben eine der größten Studienzentralen Deutschlands, ganz besonders in der Uro-Onkologie.
Der Vorteil für den Patienten ist dabei vor allem, dass er an Mittel kommt, die noch nicht offiziell auf dem Markt sind, oder?
Prof. Wirth: Richtig. Gegebenenfalls kann er wirksame Medikamente nutzen, die noch nicht komplett zugelassen sind. Viele Patienten mit Prostata-Krebs haben neue Substanzen bekommen und dadurch noch einmal einige Jahre gute Lebensqualität gehabt, weil sie die Medikamente als erste in Deutschland zur Verfügung hatten.
Wie ist das Verhältnis Mittel zu Placebo in einer Studie?
Prof. Wirth: Meistens zwei zu eins, also ein Drittel der Probanden bekommt das Placebo und zwei Drittel den Wirkstoff. Bei den meisten Studien gibt es dann ein sogenannter Cross-Over. Wenn sich gezeigt hat, dass die aktive Substanz wirkt, dürfen die Placebo-Patienten auf dieses Mittel wechseln. Das ist fair. Prof. Wirth: Diese Möglichkeit gibt man dem Erkrankten dann schon, bevor die Substanz zugelassen ist. Denn selbst wenn das Mittel wirkt, dauert es meist noch ein Jahr oder länger, bis es wirklich verfügbar ist. Auch für die Patienten, die es sich finanziell nicht leisten könnten, ist das ein großer Vorteil.
Steigen durch die Entwicklungskosten auch die Kosten der Behandlung?
Prof. Wirth: Absolut, wir haben im Moment sehr teure Behandlungskosten. Inzwischen liegen sie für neue Medikamente bei etwa 40.000 bis 50.000 Euro pro Jahr.
»Bei den meisten Studien gibt es ein Cross-Over, also wenn sich gezeigt hat, dass die aktive Substanz wirkt, dürfen die Placebo-Patienten auf dieses Mittel wechseln.«
Patienten stehen immer vor der Wahl, wo sie sich behandeln lassen sollten. Was sind die Vorteile der Urologie der Uniklinik?
Prof. Wirth: Wir haben in der Klinik viele Vorteile. Als ein sehr großes Zentrum verfügen wir über besondere Erfahrungen auf unserem Fachgebiet. Wir operieren z. B. sehr viel. Damit erreichen wir eine sehr niedrige Sterblichkeit. Bei den großen urologischen Eingriffen können wir uns deshalb mit den besten Zentren weltweit vergleichen. Vor kurzem haben wir unsere Daten wieder auf dem Amerikanischen Urologenkongress vorgestellt, zum Beispiel zum Ersatz der Blase bei Blasenkrebs. Dort haben wir ebenfalls mit < 1% eine der niedrigsten Sterblichkeitsraten weltweit. Wir sind da auf einer Linie zum Beispiel mit der UCLA (University of California). Auch aus anderen großen Studien wissen wir, dass es Kliniken gibt, die eine Mortalität haben, die gegenüber unserer um ein Mehrfaches höher ist. Das heißt, dadurch, dass wir so viel machen, Erfahrung haben und ein sehr großes Zentrum sind, ist hier die Expertise auch sehr groß. Analog gilt das auch für andere Erkrankungen.
Welche Faktoren beeinflussen diesen Effekt?
Prof. Wirth: Der Operateur spielt natürlich eine wesentliche Rolle, aber auch das ganze Umfeld. Wir haben eine eigene Intensivstation, wo wir die Patienten sorgfältig nachbetreuen können. Dort sind auch die Leute vor Ort, die permanent mit dem Fall zu tun haben, und nicht immer jemand anderes. Für so eine Qualität braucht man aber auch eine gute Struktur. Wir haben auch extrem erfahrene Oberärzte und Fachärzte. Wenn ich selbst nicht verfügbar bin, gibt es immer noch mehrere A-Teams. In kleineren Häusern gibt es davon oft nur eins, und wenn dieses einmal nicht da ist, läuft auch nichts richtig. Neben der Intensivstation haben wir fünf eigene OP-Säle und vier Stationen mit insgesamt 88 Betten. Dazu außerdem ein großes Labor und eine große Poliklinik für die ambulanten Behandlungen.
Wie ist es mit der technischen Ausstattung?
Prof. Wirth: Ich kenne keine deutsche urologische Klinik die besser ausgestattet ist. Wir haben praktisch alles an Technik verfügbar, vom OP-Roboter bis hin zu unterschiedlichen Laserverfahren, minimal-invasiven Methoden, wirklich alles, was man haben sollte.
Und ausgezeichnetes Personal...
Prof. Wirth: Das Personal ist exzellent ausgebildet, angefangen von der Schwester, MTA´s und Ärzten. Auf meine Mitarbeiter bin ich sehr stolz. Aus oben geannten Gründen kommen viele Patienten zu uns auch von weit her.
Sind Sie auch bei Transplantationen führend?
Prof. Wirth: Ja, da sind wir auch im oberen Bereich angesiedelt, vorwiegend bei Nierentransplantationen. Da ist unser Zentrum auch relativ groß, obwohl unsere Randlage in Deutschland nicht so einfach ist. Das hängt auch damit zusammen, dass wir eine excellente Nephrologie haben mit der wir sehr gut zusammenarbeiten.
Wie ist die Entwicklung im Transplantationsbereich?
Prof. Wirth: Schlecht! Wir haben zu wenig Spenderorgane. Die Warteliste ist sehr lang. Wir haben eben in Deutschland eine gesetzliche Lösung, die nicht funktioniert. Man versucht immer, daran zu drehen, aber so lange man die Angehörigen um Erlaubnis bitten muss, ist es problematisch. In anderen Ländern wie Österreich und Spanien gibt es solche Probleme nicht, dort sind alle automatisch Spender oder müssen ausdrücklich widersprechen. Dahin müssen wir politisch erst noch kommen. Die technischen Voraussetzungen haben wir bereits.